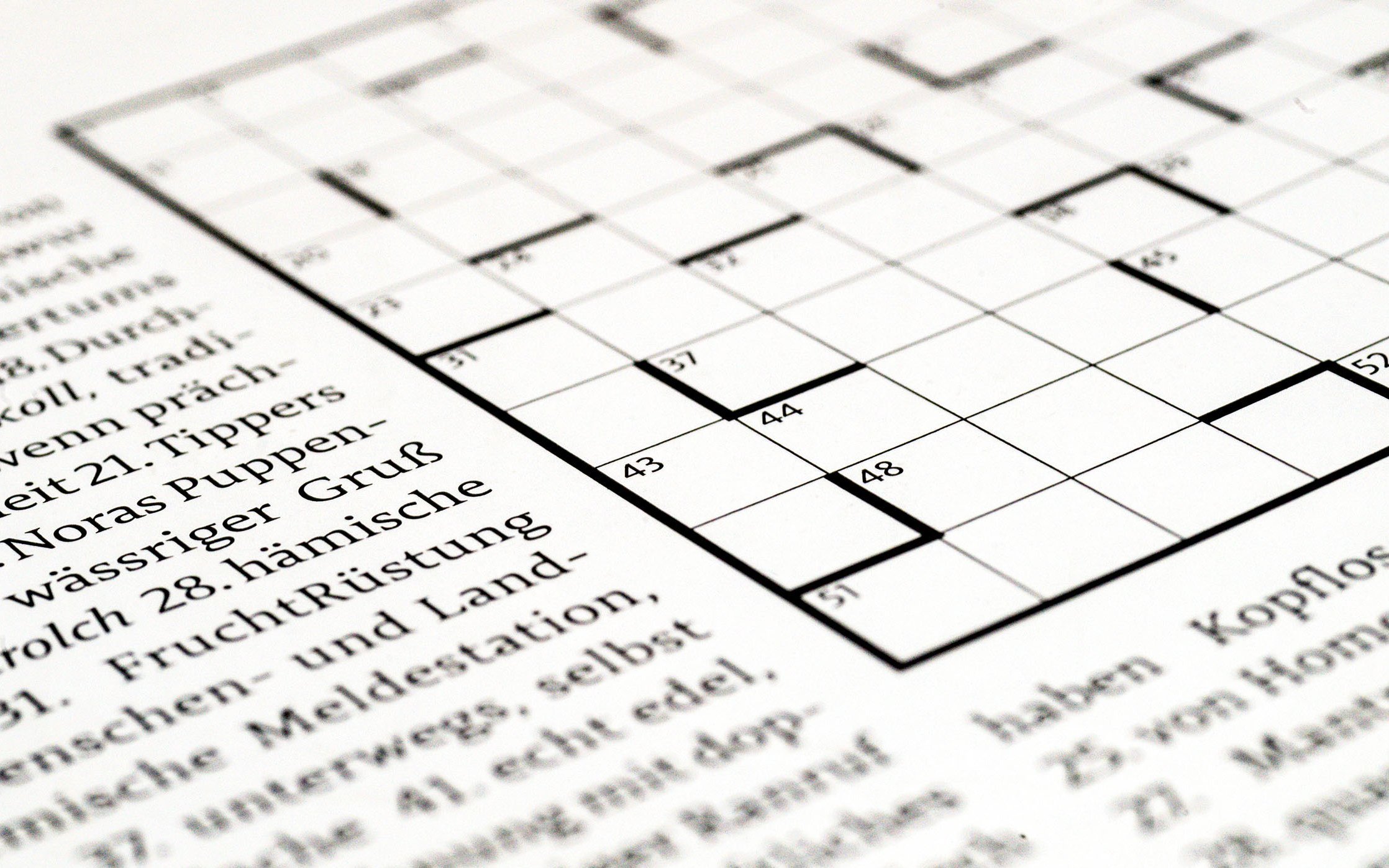Buch- und CD-Tipps
Lesen und Hören
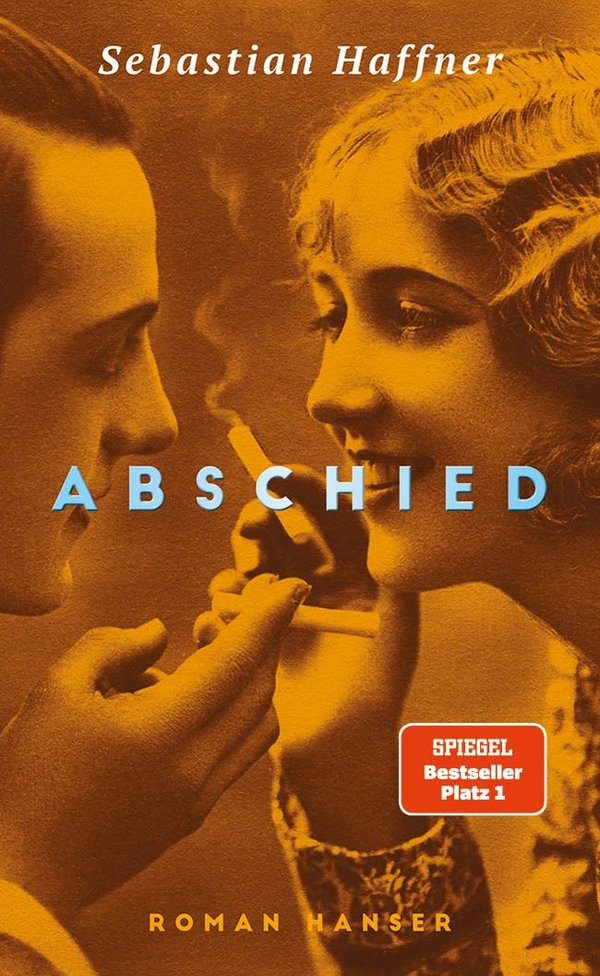
BUCHTIPP
Von Liebe und Freiheit
Von Antje Bohnhorst
Im Jahr 1932 verfasst der junge Rechtsreferendar Raimund Pretzel einen Roman, der zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht werden sollte. Noch ahnt der junge Mann nicht, dass er, zunächst im Exil in England, später, nach dem Krieg, auch in Deutschland, unter dem Pseudonym Sebastian Haffner ein bedeutender Publizist und Historiker werden sollte. Fast 100 Jahre später wurde der Roman „Abschied“ nun aus dem Nachlass veröffentlicht und darf als literarische Entdeckung des Jahres gelten. Paris, 1931: Der junge Rechtsreferendar Raimund hat einen kurzen Urlaub genutzt, um seine große Liebe Teddy zu besuchen, eine moderne junge Frau, die in der Stadt der Liebe studiert. Er erzählt die letzten beiden Tage vor seiner Abreise nach Berlin – die Uhr tickt, es gibt noch so viel zu erleben, so viel Ungesagtes, so viele Ablenkungen, so viele Verehrer Teddys; Bohème-Studenten, die Raimund so viel interessanter erscheinen als so ein preußischer Jurist mit geregeltem Tagesablauf … Ein ebenso zarter wie hellsichtiger, ebenso leichter wie melancholischer, gleichzeitig sachlich und zärtlich, atemlos sowie selbstironisch erzählter Roman, der vordergründig die Zerbrechlichkeit der Liebe zwischen Raimund und Teddy erahnen lässt, aber auch eine Momentaufnahme einer Generation junger Menschen ist, die noch nicht ahnen können, dass ihr sorgloser, kosmopolitischer Lebensstil bald bedroht sein wird. Und doch: Sebastian Haffner muss es geahnt haben – eingeschrieben in diese äußerlich leichtfüßig erscheinenden Seiten scheint eine Vorahnung der späteren Exil-Erfahrungen vieler Menschen aus dieser Generation. So gibt es mehrere Gründe, aus denen man gern mit Raimund die Zeit anhalten würde: um diese Freiheit und Sorglosigkeit zu bewahren, um den Abschied von Paris und von Teddy hinauszuzögern und um den Lesegenuss zu verlängern.
Sebastian Haffner: Abschied, Roman, Hanser 2025, 192 Seiten, 24 Euro
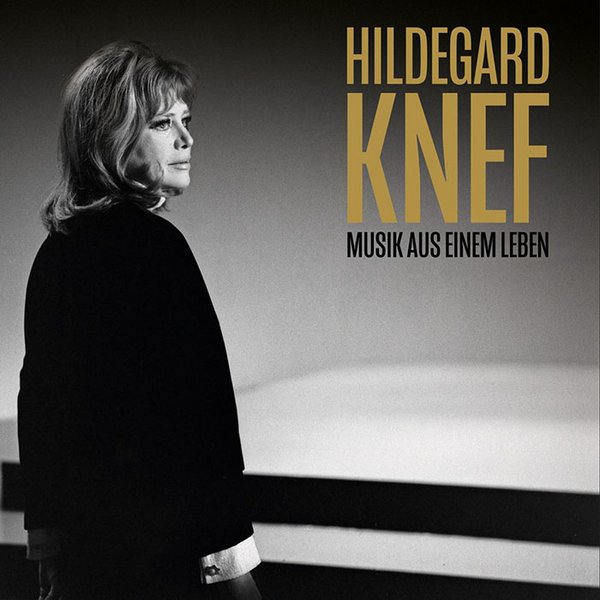
CD-TIPP
Ein Leben in Liedern
Von Antje Bohnhorst
Große runde Geburtstage werfen ihre Schatten voraus: Ende März erschien eine Anthologie zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef, der Ende dieses Jahres gefeiert wird. „Hildegard Knef: Musik aus einem Leben“ versammelt 43 Lieder aus dem umfangreichen Schaffen der „besten Sängerin ohne Stimme“, wie Ella Fitzgerald über Hildegard Knef sagte. Sie war der erste deutsche Filmstar nach dem Zweiten Weltkrieg, doch Filme wie „Die Mörder sind unter uns“ und „Die Sünderin“ machten sie nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. So wandte sie sich einer Filmkarriere in den USA zu; dort war sie die einzige Deutsche, die in einer Hauptrolle in einem Broadway-Musical debütierte. Neben und nach ihrer einzigartigen Film-Karriere trat sie seit den 50er-Jahren international und seit den 60er-Jahren vermehrt in Deutschland als Chansonnière auf. Ihr Repertoire ging dabei von Schlagern und Balladen über Chansons bis hin zu Lounge-Jazz. Diese Bandbreite ist auf den beiden CDs gut abgebildet – von ihren bekanntesten Songs bis hin zu weniger bekannten Perlen. Neben großartiger Musik, perfekten Arrangements und der rauchigen, schnoddrigen Stimme, die ihr Markenzeichen war, beeindrucken vor allem die z.T. von ihr selbst geschriebenen Texte – niemals kitschig, meist frech, manchmal desillusioniert, oft witzig und immer, selbst bei „echten“ Liebesliedern, mit einer gewissen ironischen Distanz. Umrahmt von drei verschiedenen Versionen ihres berühmtesten Stücks „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, entfaltet sich hier in der thematischen Auswahl auch tatsächlich ein Leben in Liedern. Eine würdige Hommage an eine große Sängerin.
Hildegard Knef: „Musik aus einem Leben“, Warner 2025, 2 CDs, 18,99 Euro
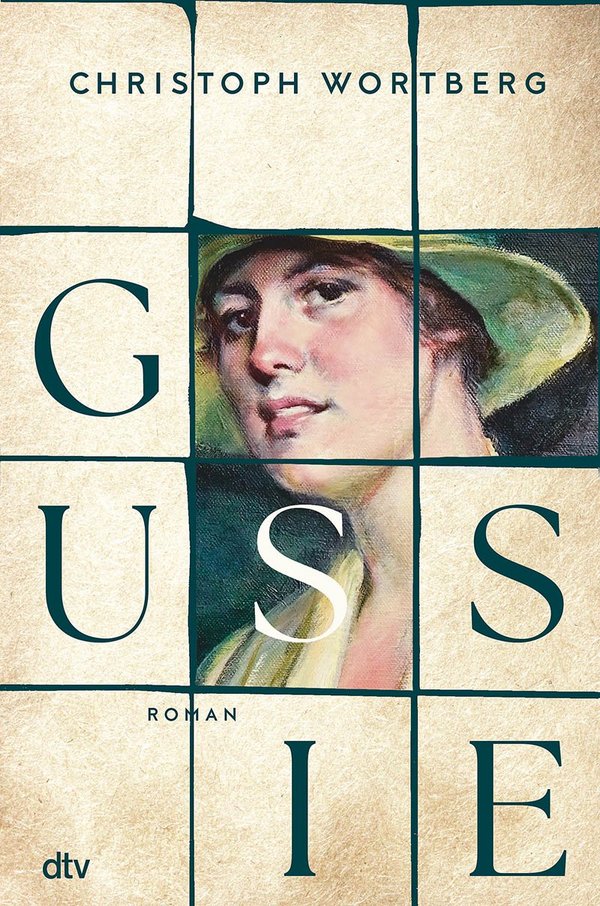
BUCHTIPP
Wann ist ein Leben gelungen?
Von Antje Bohnhorst
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, heißt es. Christoph Wortberg wurde durch den Spitznamen „Gussie“ auf die Frau aufmerksam, die an der Seite eines der bedeutendsten deutschen Politiker stand: Wer war die Frau, die 1919 den fast 20 Jahre älteren Witwer mit drei Kindern, Konrad Adenauer, heiratete? Wortberg nähert sich dem Leben dieser Frau, die viel mehr war als die „Frau an seiner Seite“, vom Ende ihres Lebens her: Während eines Krankenhausaufenthalts erinnert sich Auguste Adenauer 1948 an die Stationen ihres Lebens: Kennenlernen, Heirat, ihre Rolle als Stiefmutter, die fünf eigenen Kinder, die Karriere ihres Mannes, die politischen Entwicklungen bis hin zum Nationalsozialismus, Repressalien und vor allem der Umgang miteinander als Paar. Die Biographie Gussie Adenauers wird nicht linear erzählt. Auf diese Art werden nach und nach ihre Persönlichkeit und die Beziehung zu ihrem Mann sichtbar und auch, wie ihre Erkrankung mit den Zeitläufen verbunden ist. Immer wieder stellt sich Gussie die Frage, wann ein Leben als gelungen gelten kann. Eine ergreifende Lektüre über eine ungewöhnliche Frau.
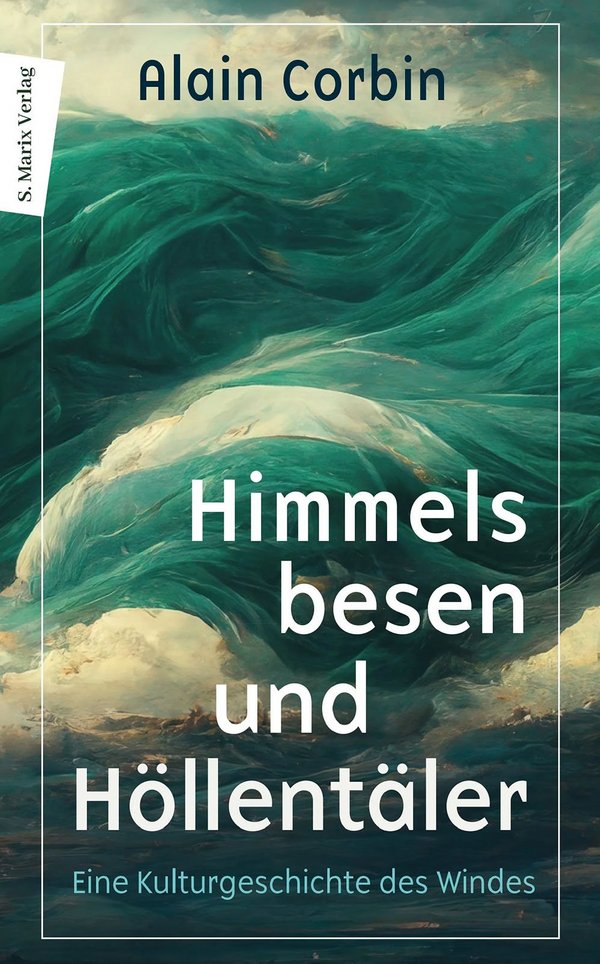
BUCHTIPP
Das himmlische Kind
Von Heidemarie Egen
„Der Wind, der Wind, das himmlische Kind“, heißt es im Märchen. Alain Corbin erzählt von diesem Zauber, indem er die von Menschen im Laufe der Zeit gesammelten Erkenntnisse spannend zusammenfügt. Heute weiß man viel über Ursachen und Wirkungsweisen des unsichtbaren Elements. Das „himmlische Kind“ ist immer da, spürbar, mal als freundlich säuselnder Begleiter, mal als tobender, ja gefährlicher Rüpel. Er beherrscht das ganze Spektrum, vor allem akustisch. Man hört ihn, ist entsetzt über die Zerstörung, die er anrichtet, und auch wieder geschmeichelt von zärtlicher Berührung. Beeindruckende Forschungsergebnisse helfen den Menschen, mit dem luftigen Element und seinen überraschenden Eigenschaften klarzukommen. Das Buch enthält sachliche und emotionale Schilderungen des Windes im Hochgebirge, im Flachland, in Wüstenregionen, an See- und Meeresufern und von seinen Wirkungen auf Fauna und Flora. Im Ganzen dürfen wir aus allem die Erkenntnis ziehen: Nicht wir Menschen beherrschen den Wind, er beherrscht uns! Ein hochinteressantes Buch.
Alain Corbin, „Himmelsbesen und Höllentäler“, Marix Verlag 2023, 176 Seiten, 22 Euro
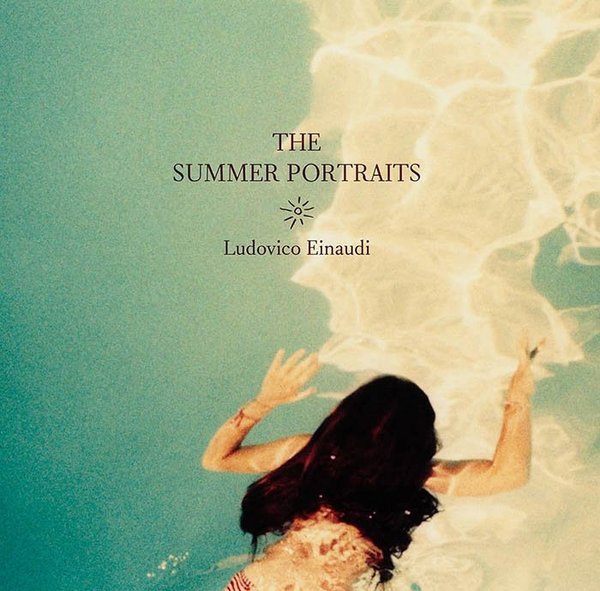
CD-TIPP
Sommerliche Klangoase
Von Antje Bohnhorst
Ludovico Einaudi, geb. 1955, gilt als einer der erfolgreichsten italienischen Komponisten der Gegenwart. Er ist der Enkel des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Luigi Einaudi, der Sohn des einflussreichen Verlegers Giulio Einaudi und der Enkel des während des Faschismus emigrierten Komponisten und Dirigenten Waldo Aldobrandi. Als Kind erlebte er, wie seine Mutter in der Musik eine Verbindung zu ihrem Vater suchte, und auch in seinem aktuellen Album „The Summer Portraits“ verarbeitet er Erfahrungen seiner Kindheit. In einem Interview berichtet er von einem kürzlichen Sommerurlaub in einer Villa auf einer Mittelmeerinsel. Dort faszinierten ihn die Gemälde, die alle aus einer Hand zu stammen schienen. Recherchen ergaben, dass die Besitzerin der Villa jedes Jahr im Sommer ein Gemälde schuf und es im Haus zurückließ. Diese Erfahrung inspirierte Einaudi dazu, sich in die Sommer seiner Kindheit zu versetzen und die Bilder seiner Erinnerungen in Musik zu gießen – wie er frei in der Natur herumstreifen und die Jahreszeit mit allen Sinnen erfahren konnte. Herausgekommen sind 13 Stücke in seinem gewohnt minimalistischen Stil, sparsam orchestriert mit Beiträgen von Théotime Langlois de Swarte (Barockvioline) und Orchesterparts, die von den Streichern des Royal Philharmonic Orchestra eingespielt wurden. Einaudi schafft eine sommerliche Oase aus Klängen, in der sich jeder in seinen eigenen Lieblingserinnerungen an die Sommer seines Lebens vertiefen kann – flirrende Hitze über dem Wasser, ruhige Stunden im Garten, bewegte Landpartien, laue Sommerabende mit Tanz – nehmen Sie sich die Zeit, diese in sich ruhenden Kompositionen zu genießen.
Ludovico Einaudi: The Summer Portraits, Decca 2025, 18,99 Euro
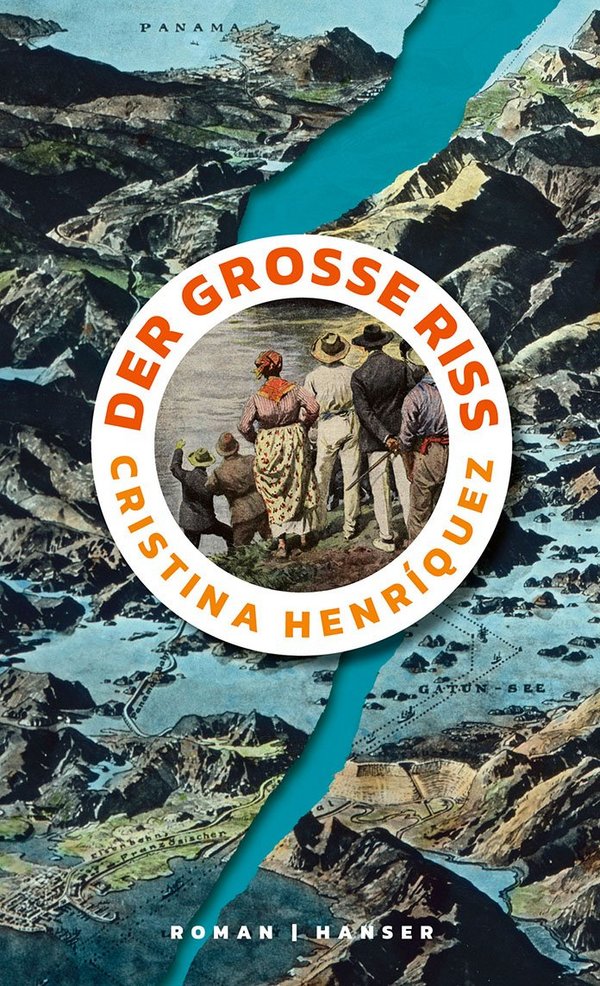
BUCHIPP
Als Amerika geteilt wurde
Von Christian Topp
Die US-amerikanische Autorin Cristina Henríquez hat ihren Roman „Der große Riss“ (im Original „The Great Divide“) an der wohl bedeutendsten Schnittstelle des amerikanischen Doppelkontinents angesiedelt – am Panamakanal. Wie so viele gewaltige Ingenieursprojekte der Neuzeit ist der Bau des Kanals Anfangs des 20. Jahrhunderts mit technokratischer Rücksichtslosigkeit durchgezogen worden. Henríquez setzt den üblichen geopolitischen und strategischen Erzählungen über die Bedeutung des Kanals ein Gewebe aus vielgliedrigen individuellen Geschichten entgegen.
Da ist die 16-jährige Ada, die aus Barbados kommt, um im Umfeld des Megaprojekts Geld für die Operation ihrer lungenkranken Schwester zu verdienen. Francisco, ein melancholischer Fischer, der beinahe seinen Sohn Omar an den Kanalbau verliert. John, ein amerikanischer Wissenschaftler, der die Malaria ausrotten will, während seine Frau Marian daran stirbt. Oder Valentina, die aus der Eintönigkeit ihres Alltags gerissen wird, als sie den Protest gegen die geplante Zwangsumsiedlung ihres Geburtsortes organisiert.
Henríquez, Tochter eines panamaischen Vaters und einer US-amerikanischen Mutter, setzt dem kolonialen Blick auf den Kanal, der derzeit in Washington wieder so populär ist, einen Perspektivwechsel entgegen. Denn wer vom Süden oder von der Mitte des Doppelkontinents aus darauf schaut, sieht eher das Trennende (Divide) als das Verbindende, das eigentlich das Wesen eines Kanals ausmachen sollte. Was aus der Vogelperspektive eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist, wird in Henríquez’ Text zurückgeschrumpft auf den sozio-ökonomischen Kern: Auch der Kanalbau ist nichts anderes als ein weiterer Akt der unendlichen Aufführung des Welttheaters. In der Mitte Amerikas wird geschuftet, geliebt, betrogen, gestorben, gehofft und – mit ein wenig Glück – überlebt.
Cristina Henríquez: „Der große Riss“, Hanser Verlag 2025, 416 Seiten, 26 Euro
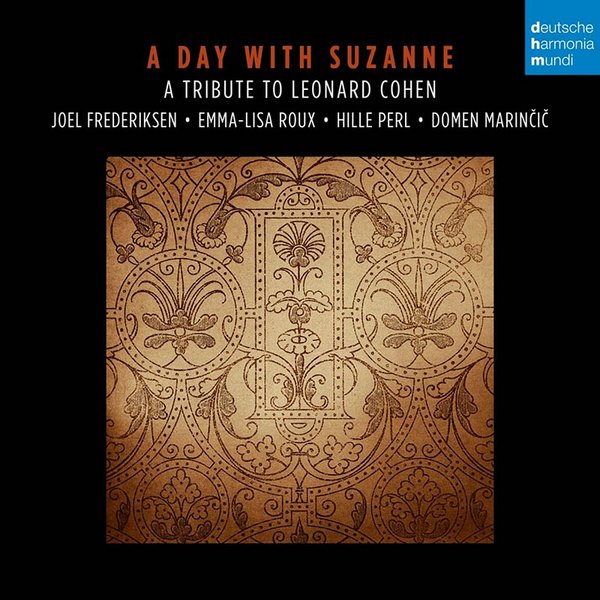
CD-TIPP
Leonard Cohen und die Renaissance
Von Antje Bohnhorst
Der amerikanische, in München lebende Bass- und Lautenist Joel Frederiksen ist als Experte für Alte Musik international renommiert (u.a. „Boston Camerata“, Opernproduktionen, „Ensemble Phoenix Munich“). Als Sänger, der sich selbst auf der Laute begleitet, gilt sein Interesse auch Liedermachern der heutigen Zeit im Dialog mit Liedern der Renaissance. Mit dem Album „A day with Suzanne. A tribute to Leonard Cohen“ ist es ihm gelungen, die verschiedenen musikalischen Ebenen feinsinnig zu verschränken. Passend zu den für Gesang/Laute (Joel Frederiksen, Bass, Emma-Lisa Roux, Sopran) und Gambe (Hille Perl, Domen Marinčič) bearbeiteten Songs von Cohen wählte er Kompositionen, die die lyrischen Motive ergänzen und kommentieren. So fügt die gegenseitige Durchdringung von „Suzanne“ mit „Susanne un jour“ von Orlando di Lasso dem Cohen-Song neue Facetten hinzu, ebenso der Abschied in „Adieu mes amours“ von Josquin des Prez mit „Hey, that’s no way to say goodbye“. „Dance me to the end of love“ wechselt sich ab mit Renaissancetänzen, „Bird on a wire“ mit Nachtigall-Tönen aus der Barockzeit. „So long, Marianne“, das Sterben einer Liebe, wird kunstvoll verschränkt mit „Le Phoenix“ von De Vincent. Zum Abschluss der CD bekommt „Hallelujah“ eine festlich jubilierende Note durch die Verschränkung mit dem „Hallelujah“ aus dem „Evening hymn“ von Henry Purcell. Der warme Bass von Joel Frederiksen und der schöne Sopran von Emma-Lisa Roux tragen zum akustischen Genuss dieses Albums bei.
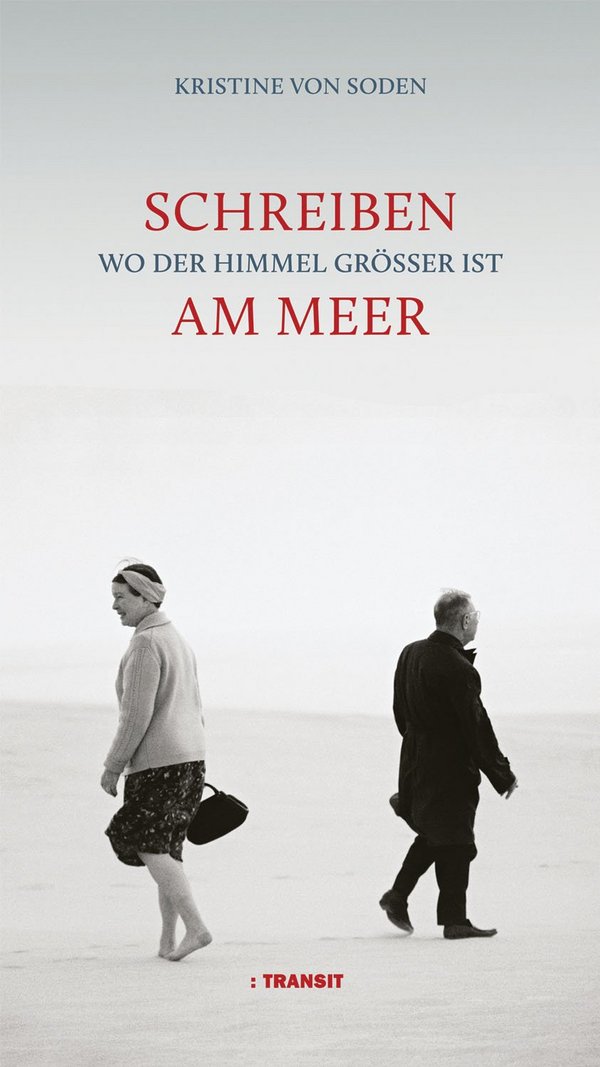
BUCHTIPP
Wasser, Wellen, Strand
Von Heidemarie Egen
Zu den besonders beliebten Urlaubszielen gehört das Meer, gehören Sehnsuchtsorte an Küsten und Stränden mit Blick übers Wasser zum weit entfernten Horizont. Wechselnde Stimmungen und Erscheinungsformen der Natur sind Glücksmomente für Menschen, die sich von Alltäglichem befreien, neue Gedanken und Ideen finden und andere Wege gehen wollen. Namhafte Autoren und Autorinnen haben am Wasser, vornehmlich im Ostseeraum, gelebt. Die Natur und das gesellschaftliche Umfeld haben auf vielfältige Art ihre schriftstellerische Arbeit inspiriert. Daraus hat die Autorin Auszüge zusammengestellt, Biografisches hinzugefügt und Einblicke in Leben und Gedankenwelt der Schreibenden geschaffen: So ist für Else Lasker-Schüler Kolberg die „Meereshauptstadt“; für George Grosz die Ostsee seine „Seelenlandschaft“; Max Frisch fühlt sich auf Sylt so „herrgöttlich“ wohl, und Siegfried Lenz ist von den „schafwolligen Schaumkronen“ fasziniert. Heinrich Heine präsentiert sich kühn als „Hofdichter der Nordsee“, und Mendelssohn-Bartholdy wird zur Hebriden-Ouvertüre inspiriert. Charmante lesenswerte Geschichten!
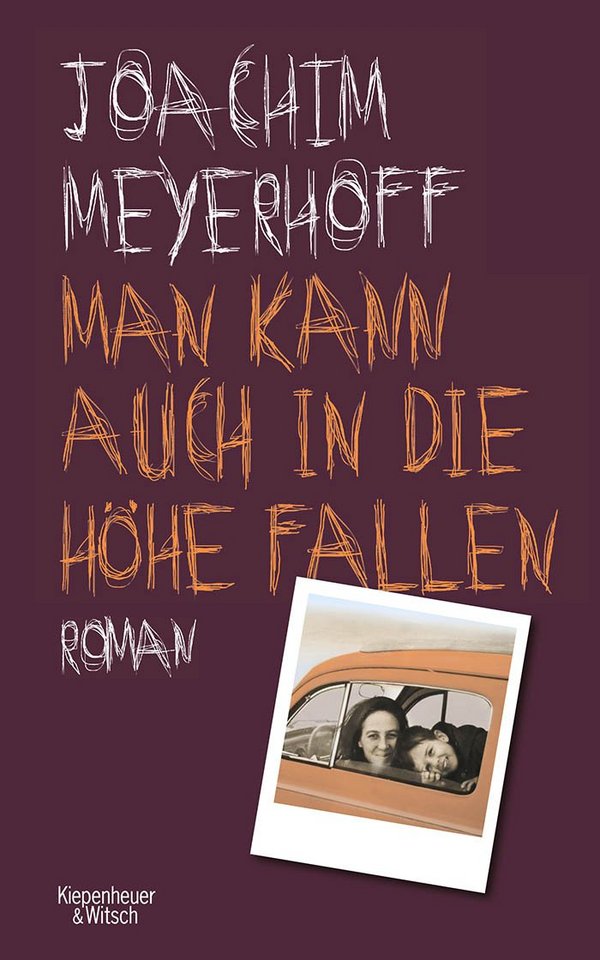
BUCHTIPP
Geschichten vom Mutterland
Von Christian Topp
Joachim Meyerhoff wird zum Naturereignis – sobald man ihm eine Bühne gibt. Das Theaterpublikum liebt ihn als intelligente Rampensau. Leserinnen und Leser verehren seine beiläufig welthaltige Kurzsatz-Prosa. „Man kann auch in die Höhe fallen“ ist bereits das sechste Buch des vielfach ausgezeichneten Schauspielers und wie alle seine Vorgänger autobiografisch geprägt. Die Rahmenhandlung ist unspektakulär: Der ausgebrannte Künstler flieht aus Berlin zu seiner 86-jährigen Mutter nach Schleswig-Holstein, um in der Landschaft seiner Kindheit wieder auf die Beine zu kommen. Anrührende, unspektakuläre Alltagsbeobachtungen verknüpft Meyerhoff beiläufig mit Anekdoten und teilweise aberwitzigen Geschichten aus dem Berufs- und Familienleben. Es entsteht eine Loseblattsammlung, die anderen Autorinnen und Autoren wohl in Beliebigkeit zerfließen würde. Meyerhoffs Text aber wird zusammengehalten von einem liebevoll klaren Blick auf sich, die Welt und vor allem auf seine Mutter, die man nach Ende der Lektüre gern einmal persönlich kennenlernen würde.
Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen, Kiepenheuer & Witsch 2024, 368 Seiten, 26 Euro
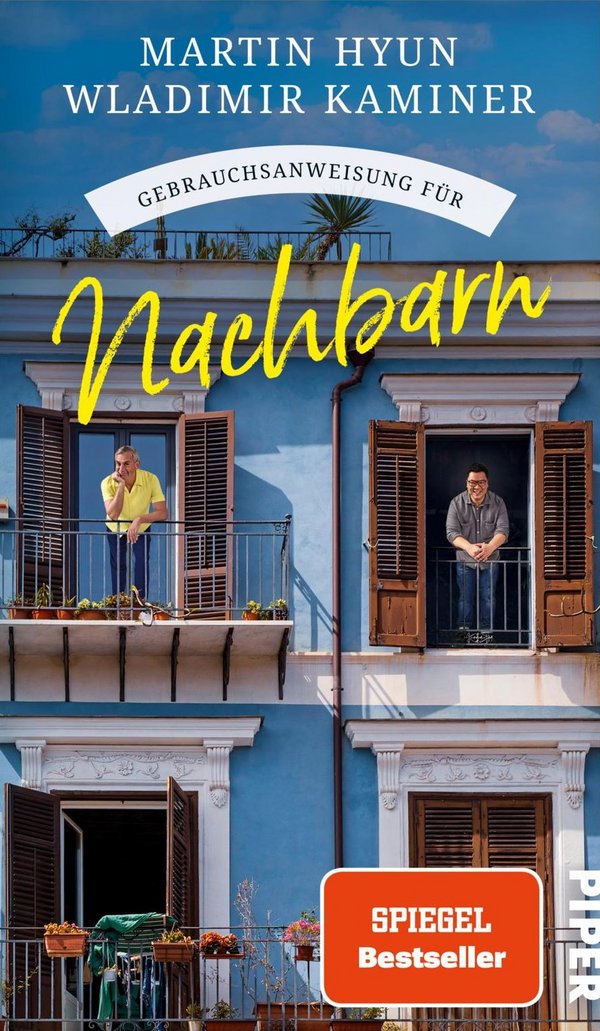
BUCHTIPP
Gebrauchsanweisung für Nachbarn
Von Antje Bohnhorst
Die beiden Autoren, die hier einen humor- und liebevollen Blick auf das Phänomen des Nachbarn werfen, haben beide einen Migrationshintergrund – und deshalb vielleicht einen erfrischend anderen Blick auf deutsche Eigenheiten. Wladimir Kaminer lebt seit 1990 in Deutschland und ist durch humorvolle Bücher mit tiefen Einsichten ins Zusammenleben der Menschen bekannt. Er beschreibt als Einstieg überzeugend, warum in einer Gemeinschaftswohnung in der Sowjetunion aufgewachsene Menschen mit milder Verwunderung und gesunder Distanz auf eifrig von wohlmeinenden Millenials geplante Gemeinschaftsaktivitäten in Berlin Mitte blicken – und sich freundlich, aber bestimmt raushalten. Martin Hyun, der als Sohn koreanischer Einwanderer in Krefeld geboren wurde, fand neben seiner Karriere als Eishockeyspieler durch die Beschäftigung mit der Geschichte seiner Familie und anderer koreanischer Einwanderer der ersten Generation, die sich vor allem unauffällig integrieren wollten, zu seiner Berufung als Schriftsteller. „Gebrauchsanweisung für Nachbarn“ ist ihr erstes gemeinsames Buch – Martin Hyun beschreibt die Arbeit daran als „eine Art literarisches Pingpong“. Hyun trägt analytische, fast philosophische Gedanken zu verschiedenen Nachbarschaftstypen bei – vom Zimmernachbarn bis zu benachbarten Ländern, gar Planeten –, Kaminer kleine literarische Gemmen von feinem, hintersinnigem Humor.
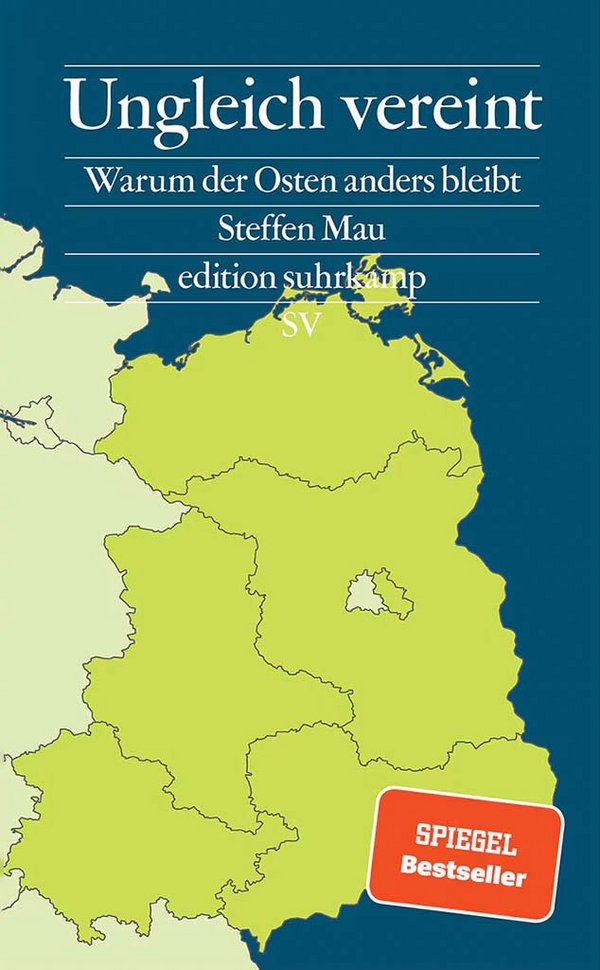
BUCHTIPP
Ohne Fraktur keine Ossifikation
Von Christian Topp
Was ist nur los im deutschen Osten? Diese Frage hört man immer wieder. Der Soziologe Steffen Mau hat im vergangenen Jahr ein schmales Bändchen veröffentlicht, das eine Antwort auf diese (vor allem westdeutsche) Frage verspricht. Seit seinem 2019 erschienenen Bestseller „Lütten Klein“ gilt er „als eine Art Haussoziologe der Ostdeutschen“ (C. Pollmer). Sein neues Buch „Ungleich vereint“ arbeitet sich auf angenehm undogmatische Weise an der These ab, dass trotz aller durchaus erfolgreichen Angleichungsbemühungen dauerhafte Unterschiede zwischen Ost und West bleiben werden. 35 Jahre nach dem Mauerfall ziehe sich immer noch eine Phantomgrenze durch das Land. Wenn man so unterschiedliche Indikatoren wie Eigentumsquote, Vereinsdichte, Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, Patentanmeldungen, Zahl der Tennisplätze, durchschnittliche Lebenserwartung von Männern u.a. auf eine Deutschlandkarte farblich projiziert, werden zwangsläufig die historischen Umrisse von DDR und BRD sichtbar, so seine Beobachtung.
Ostdeutsche Biografien sind geprägt von Frakturen, von Brüchen im Lebenslauf. Diese bereits in seinem Lütten-Klein-Buch ausgebreitete These ergänzt Mau nun durchaus originell um den medizinischen Begriff der „Ossifikation“. Das kann Verknöcherung bedeuten, aber auch Knochenbildung, Regeneration nach einem Bruch und Narbenbildung. Als Gedankenspiel – wie Mau es versteht – eröffnet dieser Begriff ein weites und deutungsoffenes Feld. Narbengewebe juckt, mal mehr, mal weniger. Die Erfahrung, dass die westdeutsche Mehrheitsgesellschaft zwar ein sehr feines Sensorium für eigene Befindlichkeiten entwickelt hat, aber beim Blick auf die „fünf neuen Länder“ die Vernarbungen der „anderen Deutschen“ völlig unsensibel ignoriert, hat auch dazu beigetragen, dass sich laut Mau ein „eigenständiger Kultur- und Deutungsraum Ostdeutschland“ herausgebildet hat – eine ostdeutsche Teilidentität. Der vielbeschworene „Aufbau Ost“ war größtenteils ein „Nachbau West“. Die Grundannahme, dass der Osten nur lang genug aufholen müsse, um automatisch zum Westen zu werden, erinnert in seiner Erfolglosigkeit an Walter Ulbrichts 1969 formuliertes Ziel der DDR-Wirtschafts- und Sozialpolitik: überholen ohne aufzuholen. Womöglich aber ist der Osten gar kein Nachzügler mehr, sondern längst ein Vorreiter. Mau verweist in seinem Buch auf ostdeutsche Entwicklungen, die längst den Westen erreicht haben: mangelnde Parteienbindung, Vertrauensschwund in Institutionen, rechtspopulistische Mobilisisierung.
Was also tun? Steffen Mau macht ein paar Vorschläge, die durchaus einen gesamtdeutschen Horizont öffnen. Er kann sich vorstellen, dass in Anknüpfung an die kurze Aufbruchszeit der DDR zwischen Mauerfall und deutscher Einheit Ostdeutschland zu einem „Labor der Partizipation“ werden könnte. Wo Parteien, Institutionen, bürgerschaftliche Initiativen keine Rolle mehr spielen, helfen Spielformen der direkten Demokratie möglicherweise weiter: Bürgerräte, runde Tische, Bürgerdialoge und andere Formen der Mitbestimmung jenseits von Parteien und Organisationen. Es ist eine Rückbesinnung, eine Wiederbelebung. Denn im heftigen Schlagschatten, den die deutsche Einheit auf sie geworfen hat, sind die meisten der zwischen 1989 und 1990 aufkeimenden basisdemokratischen Pflänzchen im Osten ganz schnell wieder eingegangen.
Steffen Mau: „Ungleich vereint“, edition suhrkamp 2024, 168 Seiten, 18 Euro
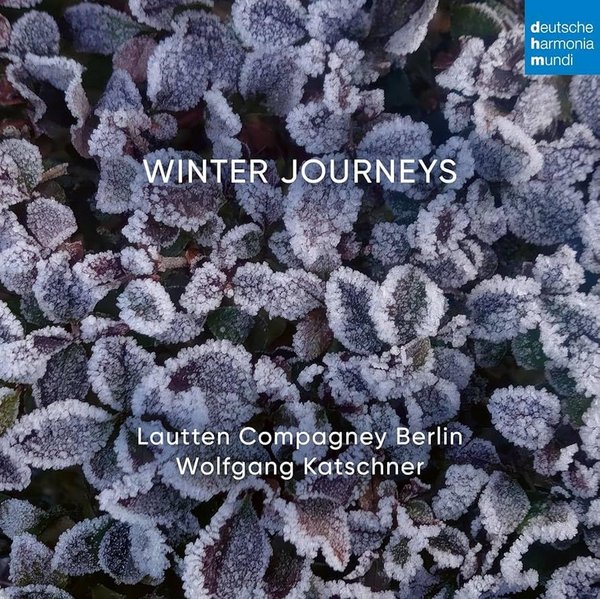
CD-TIPP
Musikalische Winterreisen
Von Heidemarie Egen
In diesem Jahr feiert die Lautten Compagney Berlin ihr vierzigjähriges Bestehen. Das Ensemble hat sich durch seine Aufführungen Alter Musik große Wertschätzung verdient. Musiker und Sänger begeistern das Publikum weltweit. „Winter Journeys“, vom Dirigenten mit „Musik auf dem Weg nach Hause“ ergänzt, ist eine ganz besondere Aufnahme. Reisen im Winter ist naturgemäß beschwerlich und voller Gefühlsschwankungen durch Naturbilder, Einsamkeit, Weihnachten, Sehnsucht nach dem Frühling, Vogelgezwitscher. Der Lautten Compagney ist es gelungen, passend zur Jahreszeit, einen musikalischen Genuss zu präsentieren!
Lautten Compagney Berlin, „Winter Journeys“, Deutsche Harmonia Mundi 2023, 19,99 Euro