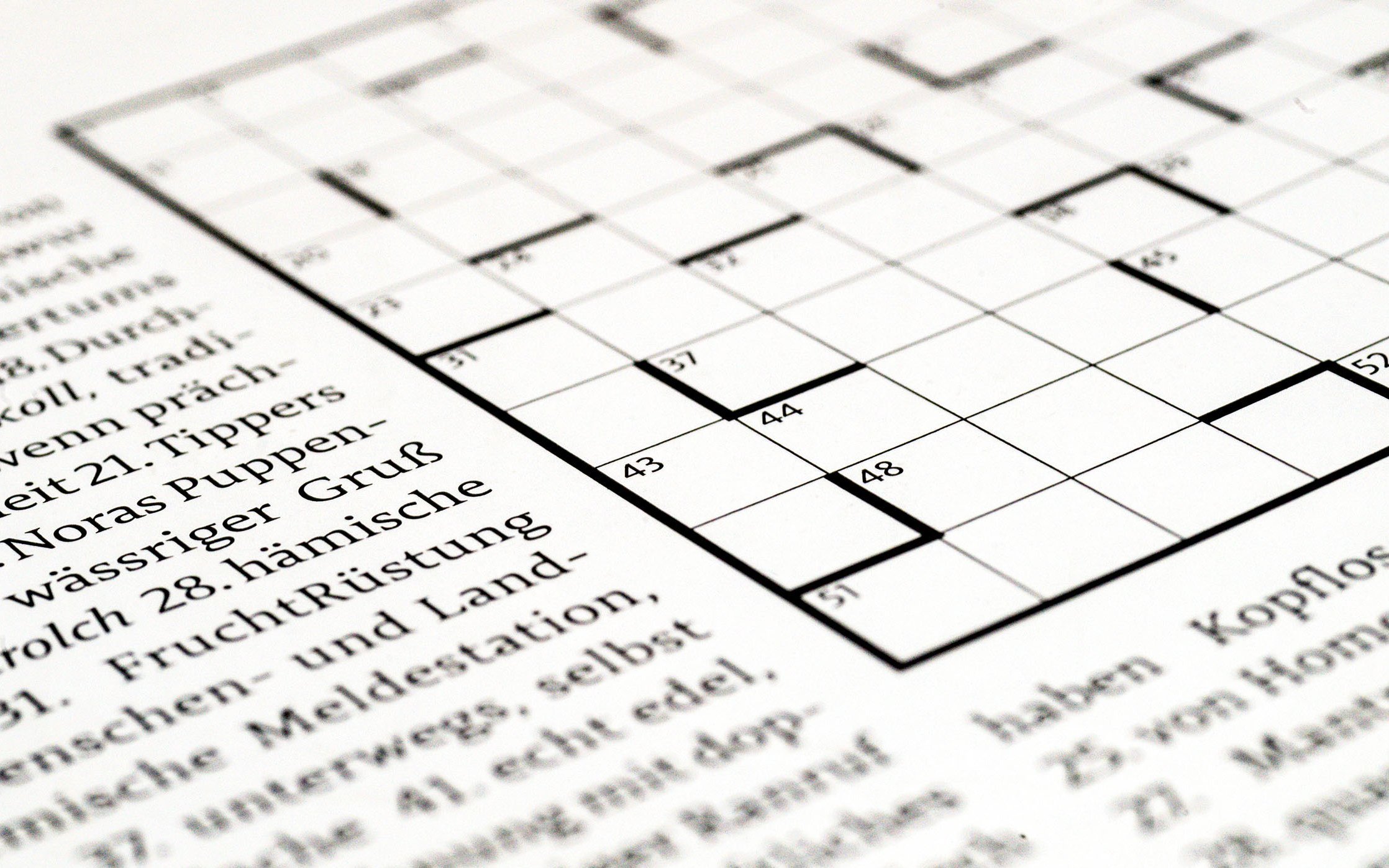Buch- und CD-Tipps
Lesen und Hören
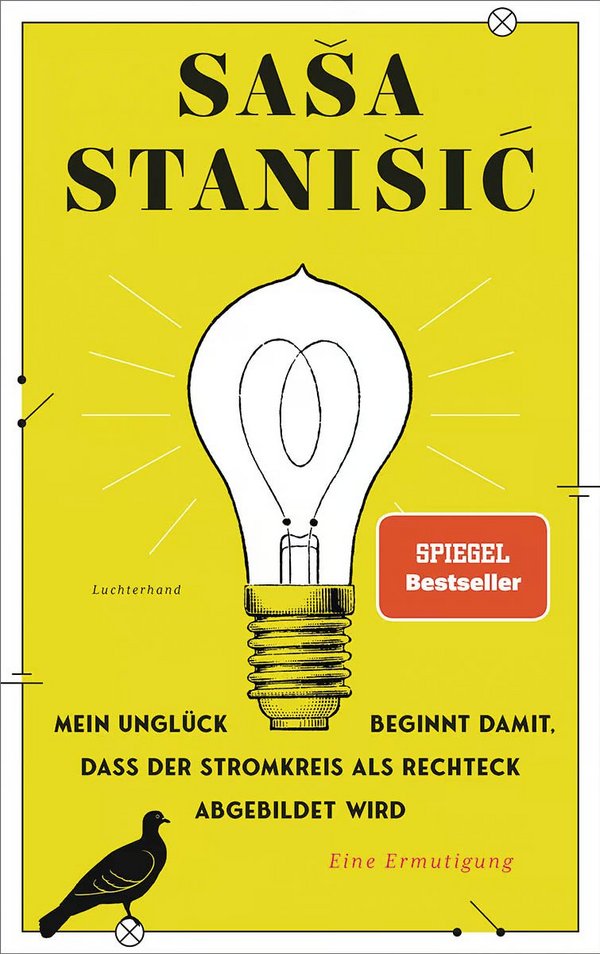
BUCHTIPP
Der Autor als Ermutiger
Von Christian Topp
In den vergangenen 20 Jahren hat Saša Stanišić mehr als 30 Preise für sein schriftstellerisches Werk bekommen. Sein jüngst erschienenes Buch erhärtet die Vermutung, dass manch eine dieser Auszeichnungen auch deshalb vergeben wurde, weil man den Autor unbedingt als Festredner für die Preisverleihung gewinnen wollte. Die zehn abgedruckten Dankesreden zeigen einen Menschen, der die seltene Gabe hat, tiefsinnige und berührende, gleichzeitig aber auch unterhaltsame Geschichten zu erzählen. Seine Reden verstecken sich nicht hinter einem theoretischen Überbau, vielmehr erzählen sie vom Leben, von der Flucht, vom Erlernen einer fremden Sprache, vom genauen Hinsehen … Und so staunt man mit dem Autor darüber, dass Stromkreise in Physikbüchern schematisch nicht rund, sondern immer als Rechtecke dargestellt werden. Oder man beschäftigt sich ganz ernsthaft mit der Frage, auf welche unterschiedliche Art verschiedene Häuser musizieren. Durch alle Reden schimmert ein Lebensthema, das Stanišić wohl seit seiner Kindheit und Jugend in Jugoslawien begleitet – das Anschreiben gegen eine Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg als normal gelten. In einer Poetikvorlesung an der Hochschule RheinMain hat er 2020 sein literarisches Programm prägnant zusammengefasst: „Literatur war immer der Gedankenstrich, der die Stimme und das Handwerk eines Autors zusammengebracht hat mit anderen Stimmen und Erfahrungen. Eine Literatur der Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, verbindet ästhetische Wucht mit ethischer Belastbarkeit. Den Willen zur Form mit dem zur Wahrheit. Überhaupt die erzählte Welt mit einer Welt, in der man leben möchte.“
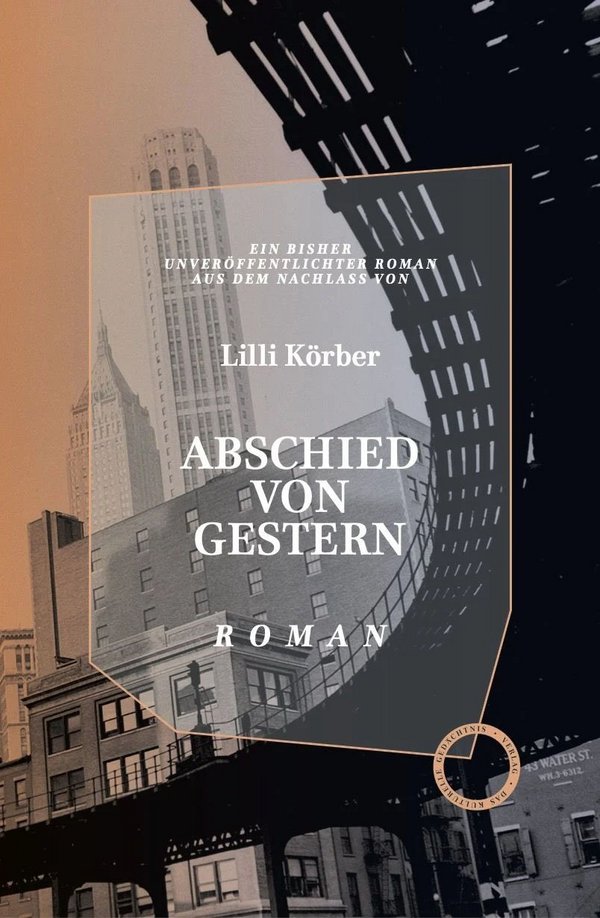
BUCHTIPP
Zwischen den Stühlen
Von Antje Bohnhorst
Lili Körber, geb. 1897, Österreicherin mit polnischen Wurzeln, hatte in den 1930er Jahren erste literarische Erfolge. 1938 emigrierte sie in die USA, und ihr Werk geriet, wie das so vieler Exilanten, in Vergessenheit. Nun erschien aus dem Nachlass ihr kurz nach dem Krieg verfasster, bisher unveröffentlichter Roman „Abschied von gestern“. Auf lebendige, mitreißende, mitfühlende und moderne Art hält sie darin das Leben der Flüchtlinge in New York fest. Genia Schicht, Pianistin, kommt 1941 mit ihrem Ehemann, einem Kinderarzt, über Paris und Lissabon nach New York. Nicht nur die Heimat und geliebte Menschen haben sie hinter sich gelassen, sondern auch die großbürgerliche Existenz: Das Budget reicht nur für ein Zimmer in einem bis unters Dach mit Flüchtlingen belegten Haus. Da Robert einige Hürden für eine Approbation in den USA zu überwinden hat, arbeitet Genia in Haushalten, wie sie selbst früher einen hatte. Schnell macht sie Bekanntschaften – und so erleben wir durch ihre Augen das alltägliche Leben der Flüchtlinge. Aber kann das Leben der Exilanten überhaupt alltäglich sein? Unverschuldete Armut, Entwurzelung, Überanpassung, Demütigung, Verzweiflung, kulturelle Unterschiede, Hoffnung – und unter allem das Grundrauschen des Krieges und der Angst um die Verwandten in Deutschland und dem besetzten Europa. Zeitungen und Radio sind lebenswichtig. Werden sie Fuß fassen in der neuen Welt oder sich immer „zwischen zwei Stühlen“, wie Lili Körber es in einem Gedicht nennt, fühlen? Wird ihre Liebe den Belastungen standhalten? Eine lohnende Neuentdeckung – eine Freundin der Autorin schrieb in einem Nachruf: „… mag ihr Lebenswerk heute … im Dunkeln sein. Es wird auferstehen, wie alles, was gekonnt und echt ist.“
Lili Körber: Abschied von gestern, Verlag Das kulturelle Gedächtnis, 2025, 317 Seiten, 26 Euro
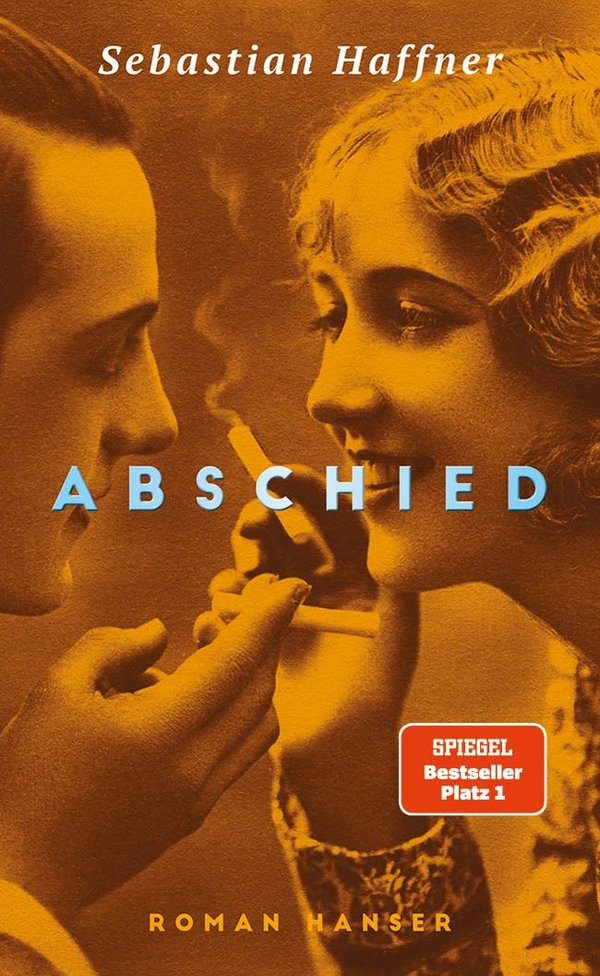
BUCHTIPP
Von Liebe und Freiheit
Von Antje Bohnhorst
Im Jahr 1932 verfasst der junge Rechtsreferendar Raimund Pretzel einen Roman, der zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht werden sollte. Noch ahnt der junge Mann nicht, dass er, zunächst im Exil in England, später, nach dem Krieg, auch in Deutschland, unter dem Pseudonym Sebastian Haffner ein bedeutender Publizist und Historiker werden sollte. Fast 100 Jahre später wurde der Roman „Abschied“ nun aus dem Nachlass veröffentlicht und darf als literarische Entdeckung des Jahres gelten. Paris, 1931: Der junge Rechtsreferendar Raimund hat einen kurzen Urlaub genutzt, um seine große Liebe Teddy zu besuchen, eine moderne junge Frau, die in der Stadt der Liebe studiert. Er erzählt die letzten beiden Tage vor seiner Abreise nach Berlin – die Uhr tickt, es gibt noch so viel zu erleben, so viel Ungesagtes, so viele Ablenkungen, so viele Verehrer Teddys; Bohème-Studenten, die Raimund so viel interessanter erscheinen als so ein preußischer Jurist mit geregeltem Tagesablauf … Ein ebenso zarter wie hellsichtiger, ebenso leichter wie melancholischer, gleichzeitig sachlich und zärtlich, atemlos sowie selbstironisch erzählter Roman, der vordergründig die Zerbrechlichkeit der Liebe zwischen Raimund und Teddy erahnen lässt, aber auch eine Momentaufnahme einer Generation junger Menschen ist, die noch nicht ahnen können, dass ihr sorgloser, kosmopolitischer Lebensstil bald bedroht sein wird. Und doch: Sebastian Haffner muss es geahnt haben – eingeschrieben in diese äußerlich leichtfüßig erscheinenden Seiten scheint eine Vorahnung der späteren Exil-Erfahrungen vieler Menschen aus dieser Generation. So gibt es mehrere Gründe, aus denen man gern mit Raimund die Zeit anhalten würde: um diese Freiheit und Sorglosigkeit zu bewahren, um den Abschied von Paris und von Teddy hinauszuzögern und um den Lesegenuss zu verlängern.
Sebastian Haffner: Abschied, Roman, Hanser 2025, 192 Seiten, 24 Euro

CD-TIPP
Ein Leben in Liedern
Von Antje Bohnhorst
Große runde Geburtstage werfen ihre Schatten voraus: Ende März erschien eine Anthologie zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef, der Ende dieses Jahres gefeiert wird. „Hildegard Knef: Musik aus einem Leben“ versammelt 43 Lieder aus dem umfangreichen Schaffen der „besten Sängerin ohne Stimme“, wie Ella Fitzgerald über Hildegard Knef sagte. Sie war der erste deutsche Filmstar nach dem Zweiten Weltkrieg, doch Filme wie „Die Mörder sind unter uns“ und „Die Sünderin“ machten sie nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. So wandte sie sich einer Filmkarriere in den USA zu; dort war sie die einzige Deutsche, die in einer Hauptrolle in einem Broadway-Musical debütierte. Neben und nach ihrer einzigartigen Film-Karriere trat sie seit den 50er-Jahren international und seit den 60er-Jahren vermehrt in Deutschland als Chansonnière auf. Ihr Repertoire ging dabei von Schlagern und Balladen über Chansons bis hin zu Lounge-Jazz. Diese Bandbreite ist auf den beiden CDs gut abgebildet – von ihren bekanntesten Songs bis hin zu weniger bekannten Perlen. Neben großartiger Musik, perfekten Arrangements und der rauchigen, schnoddrigen Stimme, die ihr Markenzeichen war, beeindrucken vor allem die z.T. von ihr selbst geschriebenen Texte – niemals kitschig, meist frech, manchmal desillusioniert, oft witzig und immer, selbst bei „echten“ Liebesliedern, mit einer gewissen ironischen Distanz. Umrahmt von drei verschiedenen Versionen ihres berühmtesten Stücks „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, entfaltet sich hier in der thematischen Auswahl auch tatsächlich ein Leben in Liedern. Eine würdige Hommage an eine große Sängerin.
Hildegard Knef: „Musik aus einem Leben“, Warner 2025, 2 CDs, 18,99 Euro

CD-TIPP
Musikalische Deutschlandreise
Von Antje Bohnhorst
Das Freiburger Barockorchester ist eins der renommiertesten Ensembles für Alte Musik. Konzertreisen führen das Orchester regelmäßig nach Stuttgart und Berlin. In der Barockzeit hätte man diese Reisen nicht mit dem ICE, sondern mit der Kutsche unternommen und an den auf dem Weg liegenden Höfen Station gemacht. Auf Reisen konnten Künstler neue Eindrücke sammeln und an den einzelnen Höfen eine Anstellung finden. Das Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von der Goltz hat für das aktuelle Album „Grand Tour“ diese Reise auf der (musikalischen) Landkarte der Barockzeit nachvollzogen und dabei in Rastatt, Nürnberg, Stuttgart, Meiningen und Eisenach Komponisten entdeckt, die nicht regelmäßig auf Konzertprogrammen stehen, aber zu ihrer Zeit durchaus einen Namen hatten. Gleichzeitig zeigt das Ensemble, wie die Musik in den deutschen Residenzen von französischen Vorbildern beeinflusst war und wo sich ein eigener Stil entwickeln konnte: Es beginnt in Rastatt mit einer frühlingshaften Suite von Johann Caspar Fischer (1656-1746). In Nürnberg begegnen wir Johann Christoph Pez (1664-1716) mit einem „Concerto Pastorale“. Johann Sigismund Kusser (1660-1727) hatte von seinen Reisen den französischen Einfluss Lullys nach Stuttgart gebracht. Wir hören seine Suite „Der verspielte Apollon“. In Meiningen tätig war ein Bach-Cousin, Johann Ludwig Bach (1677-1731), dessen Ouvertüre in G-Dur elegante Schlichtheit ausstrahlt. Georg Philipp Telemann (1681-1767) besucht das Orchester in Eisenach, wo er eine Hofkapelle aufbaute – eine Gelegenheit, sein Konzert für Flöte und Violine in das Programm aufzunehmen. In Berlin endet die Reise schließlich nach 800 Kilometern mit dem Brandenburgischen Konzert Nr. 2 von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die gleichzeitig feinsinnige und temperamentvoll-spritzige Live-Aufnahme zeigt, dass der Weg das Ziel sein kann.
Freiburger Barockorchester: Grand Tour, Aparte 2025, 19,99 Euro
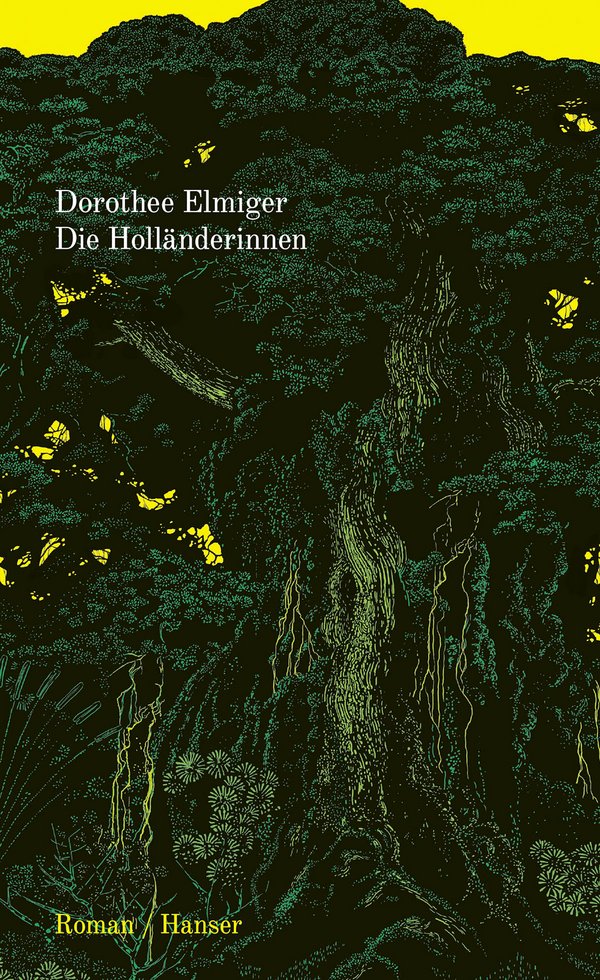
BUCHTIPP
Mitten hinein ins Herz der Finsternis
Von Christian Topp
Vordergründig verhandelt Dorothee Elmiger in ihrem Roman „Die Holländerinnen“ einen True-Crime-Fall aus dem Jahr 2014. Damals verschwanden zwei Touristinnen im Dschungel von Panama. Was im ersten Moment nach einem vor allem kriminalistischen Plot klingt, wird bei der diesjährigen Buchpreisträgerin auf literarisch hochspannende Art aufgebrochen. Die autofiktionale Ich-Erzählerin, eine erfolgreiche Schriftstellerin, erzählt im Rahmen einer Poetik-Vorlesung einem mäßig interessierten Publikum die Geschichte einer ungewöhnlichen und erschütternden Spurensuche in der Wildnis. Fast durchgehend arbeitet der Text dabei mit indirekter Rede. Das wirkt im ersten Moment wie eine sehr artifizielle und eher angestrengte Konstruktion, wird aber beim Lesen zur Sensation. Elmigers Sprache erinnert an Thomas Bernhards musikalisch rhythmisierte Satzmelodie, verfällt aber inhaltlich nicht dem Furor und Welthass des Österreichers. Vielmehr untersucht die Autorin, wie man überhaupt von etwas erzählen kann, das man nicht erlebt hat. Die Konstruktion des kurzen Romans führt mitten hinein in das „Herz der Finsternis“ – in den bedrohlich dunklen, immerfeuchten und höchst lebendigen Urwald. Dass die Autorin wie nebenbei auch noch ein gewaltiges Referenz-Netzwerk mit Verweisen auf Kulturgeschichte, Philosophie, Kolonialismus und Populärkultur in ihren Text eingeflochten hat, bietet allen, die gerne Rätsel dechiffrieren, eine weitere, sehr spannende Lektüre-Ebene.
Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen, Hanser Verlag 2025, 160 Seiten, 23 Euro
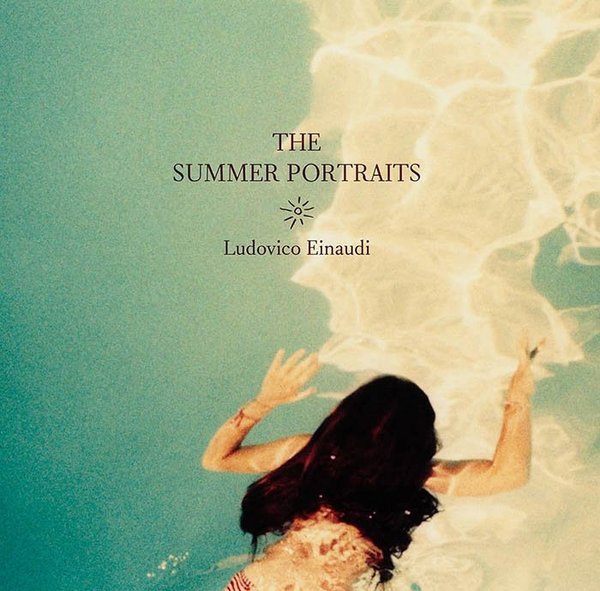
CD-TIPP
Sommerliche Klangoase
Von Antje Bohnhorst
Ludovico Einaudi, geb. 1955, gilt als einer der erfolgreichsten italienischen Komponisten der Gegenwart. Er ist der Enkel des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Luigi Einaudi, der Sohn des einflussreichen Verlegers Giulio Einaudi und der Enkel des während des Faschismus emigrierten Komponisten und Dirigenten Waldo Aldobrandi. Als Kind erlebte er, wie seine Mutter in der Musik eine Verbindung zu ihrem Vater suchte, und auch in seinem aktuellen Album „The Summer Portraits“ verarbeitet er Erfahrungen seiner Kindheit. In einem Interview berichtet er von einem kürzlichen Sommerurlaub in einer Villa auf einer Mittelmeerinsel. Dort faszinierten ihn die Gemälde, die alle aus einer Hand zu stammen schienen. Recherchen ergaben, dass die Besitzerin der Villa jedes Jahr im Sommer ein Gemälde schuf und es im Haus zurückließ. Diese Erfahrung inspirierte Einaudi dazu, sich in die Sommer seiner Kindheit zu versetzen und die Bilder seiner Erinnerungen in Musik zu gießen – wie er frei in der Natur herumstreifen und die Jahreszeit mit allen Sinnen erfahren konnte. Herausgekommen sind 13 Stücke in seinem gewohnt minimalistischen Stil, sparsam orchestriert mit Beiträgen von Théotime Langlois de Swarte (Barockvioline) und Orchesterparts, die von den Streichern des Royal Philharmonic Orchestra eingespielt wurden. Einaudi schafft eine sommerliche Oase aus Klängen, in der sich jeder in seinen eigenen Lieblingserinnerungen an die Sommer seines Lebens vertiefen kann – flirrende Hitze über dem Wasser, ruhige Stunden im Garten, bewegte Landpartien, laue Sommerabende mit Tanz – nehmen Sie sich die Zeit, diese in sich ruhenden Kompositionen zu genießen.
Ludovico Einaudi: The Summer Portraits, Decca 2025, 18,99 Euro

BUCHIPP
Als Amerika geteilt wurde
Von Christian Topp
Die US-amerikanische Autorin Cristina Henríquez hat ihren Roman „Der große Riss“ (im Original „The Great Divide“) an der wohl bedeutendsten Schnittstelle des amerikanischen Doppelkontinents angesiedelt – am Panamakanal. Wie so viele gewaltige Ingenieursprojekte der Neuzeit ist der Bau des Kanals Anfangs des 20. Jahrhunderts mit technokratischer Rücksichtslosigkeit durchgezogen worden. Henríquez setzt den üblichen geopolitischen und strategischen Erzählungen über die Bedeutung des Kanals ein Gewebe aus vielgliedrigen individuellen Geschichten entgegen.
Da ist die 16-jährige Ada, die aus Barbados kommt, um im Umfeld des Megaprojekts Geld für die Operation ihrer lungenkranken Schwester zu verdienen. Francisco, ein melancholischer Fischer, der beinahe seinen Sohn Omar an den Kanalbau verliert. John, ein amerikanischer Wissenschaftler, der die Malaria ausrotten will, während seine Frau Marian daran stirbt. Oder Valentina, die aus der Eintönigkeit ihres Alltags gerissen wird, als sie den Protest gegen die geplante Zwangsumsiedlung ihres Geburtsortes organisiert.
Henríquez, Tochter eines panamaischen Vaters und einer US-amerikanischen Mutter, setzt dem kolonialen Blick auf den Kanal, der derzeit in Washington wieder so populär ist, einen Perspektivwechsel entgegen. Denn wer vom Süden oder von der Mitte des Doppelkontinents aus darauf schaut, sieht eher das Trennende (Divide) als das Verbindende, das eigentlich das Wesen eines Kanals ausmachen sollte. Was aus der Vogelperspektive eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist, wird in Henríquez’ Text zurückgeschrumpft auf den sozio-ökonomischen Kern: Auch der Kanalbau ist nichts anderes als ein weiterer Akt der unendlichen Aufführung des Welttheaters. In der Mitte Amerikas wird geschuftet, geliebt, betrogen, gestorben, gehofft und – mit ein wenig Glück – überlebt.
Cristina Henríquez: „Der große Riss“, Hanser Verlag 2025, 416 Seiten, 26 Euro
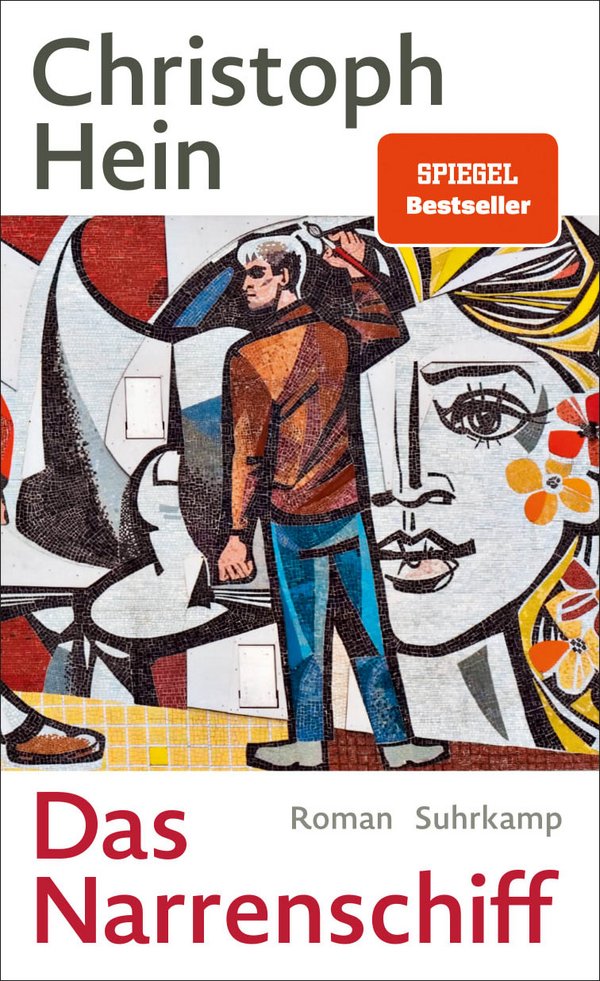
BUCHTIPP
Chronik des Scheiterns
Von Antje Bohnhorst
„Eine richtige Seite, eine Seite, auf der man, ohne schamrot zu werden, stehen konnte, wird es wohl nicht mehr geben. Und wo ich heute stehe, … das weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht auf dem Deck eines Narrenschiffs.“ Auf 750 Seiten erzählt Christoph Hein nüchtern, trocken, eher chronistisch die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik von ihrer Gründung bis zur Wiedervereinigung. Den einleitend zitierten Satz sagt Karsten Emser, Ökonom und Mitglied des Zentralkomitees, und er charakterisiert damit das Verhalten fast aller Personen des Romans, egal auf welcher Seite sie im Kalten Krieg stehen: Opportunismus – aus den verschiedensten Gründen. Emser selbst, der die Säuberungen unter Exil-Deutschen in Moskau 1937 miterlebt hat, geht es vor allem um das Überleben – zunächst ganz wörtlich genommen, später in der DDR in einem Klima, in dem sein Fachwissen nicht gefragt ist und die Parteilinie wider besseres Wissen durchgesetzt werden muss. Johannes Goretzka geht es dagegen hauptsächlich um persönliche Vorteile; vom begeisterten Anhänger der Nationalsozialisten wandelt er sich aus Opportunismus zum überzeugten Sozialisten, der in der jungen DDR für sich und seine Frau Beziehungen nutzt, um einflussreiche Positionen zu erlangen. Nur sein fachlicher Übereifer, gepaart mit mangelndem Einfühlungsvermögen, verhindert sein weiteres Fortkommen. Er verbittert zunehmend. Benaja Kuckuck wiederum, renommierter Literaturwissenschaftler, kommt aus Überzeugung aus dem britischen Exil zurück nach Deutschland, nur um zu erleben, dass er im Westen als Kommunist und im Osten als Kosmopolit beargwöhnt wird – sein Opportunismus soll das blanke Überleben auf diesem ihm als Intellektuellem fremden Parkett sichern. Alle Figuren und auch ihre Ehefrauen haben allerdings die Zeit des Nationalsozialismus als dem Regime verdächtige bzw. unerwünschte Personen erlebt, was ihr späteres Verhalten vielleicht verständlich macht. Die Geschehnisse, erlebt und immer wieder schonungslos diskutiert und kommentiert von den Figuren des Romans, legen den Schluss nahe, dass der DDR das Scheitern schon bei ihrer Gründung eingeschrieben war und die Personen am Steuer des Staatsschiffs jegliche Versuche, den Kurs zu ändern, im Keim erstickten. So machen die Ereignisse des Jahres 1989 und die erste Zeit danach als unausweichliche, nur aufgeschobene, nicht abgewendete Konsequenz nur noch wenige Kapitel am Schluss des Romans aus. Christoph Hein verschweigt nicht, dass nach der Grenzöffnung nicht plötzlich alles rosig ist. Hoffnung auf einen Neuanfang gewährt er aber der jüngeren Generation, den Kindern und Enkeln der Familie Goretzka. Eine schonungslose, aber auch nicht ohne Sympathie für die ursprünglichen Ziele und Hoffnungen der Protagonisten erzählte Tour de Force durch die Geschichte der DDR.
Christoph Hein: Das Narrenschiff, Roman, Suhrkamp 2025, 28 Euro
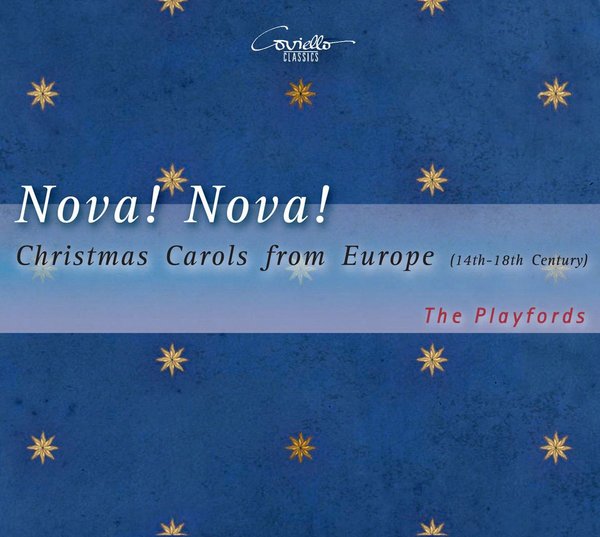
CD-TIPP
Nova! Nova! – Die gute Neuigkeit
Von Antje Bohnhorst
Das 2001 in Weimar gegründete Ensemble „The Playfords“ (Björn Werner – Gesang, Annegret Fischer – Blockflöten, Claudia Mende – Barockvioline, Benjamin Dreßler – Viola da gamba, Nora Thiele – Perkussion, Erik Warkenthin – Barockgitarre, Laute, Chitarrone) arrangiert, basierend auf gründlicher Recherche, Alte Musik so, dass sie frisch und tanzbar klingt. Ihr Weihnachts-Album hebt sich wohltuend aus der Masse der Weihnachtsaufnahmen heraus. Das Ensemble hat Weihnachtslieder vom 14. bis zum 18. Jahrhundert aus ganz Europa zusammengestellt. Das Album beginnt ganz besinnlich mit einem zarten Weihnachtsglöckchen und dem entsprechend arrangierten französischen Prozessionsgesang „Veni, veni Emanuel“. Manche alten Bekannten sorgen für akustische Überraschungen, wie das hier tanzbar arrangierte „O Heiland reiß die Himmel auf“ und das besinnliche „Es kommt ein Schiff geladen“. Zumindest in Deutschland mit seiner reichen Weihnachtslieder-Tradition weniger bekannte Lieder aus Spanien, Frankreich und England zeigen, dass die Weihnachtstraditionen im Mittelalter nicht immer so besinnlich und introspektiv waren, wie wir es heute zu kennen glauben. Die gute Neuigkeit der Geburt Jesu wurde fröhlich mit Tänzen und Gesang gefeiert – schön, dass wir dank der „Playfords“ diese besinnliche und freudige Atmosphäre und diesen musikalischen Genuss in unser Wohnzimmer holen können.
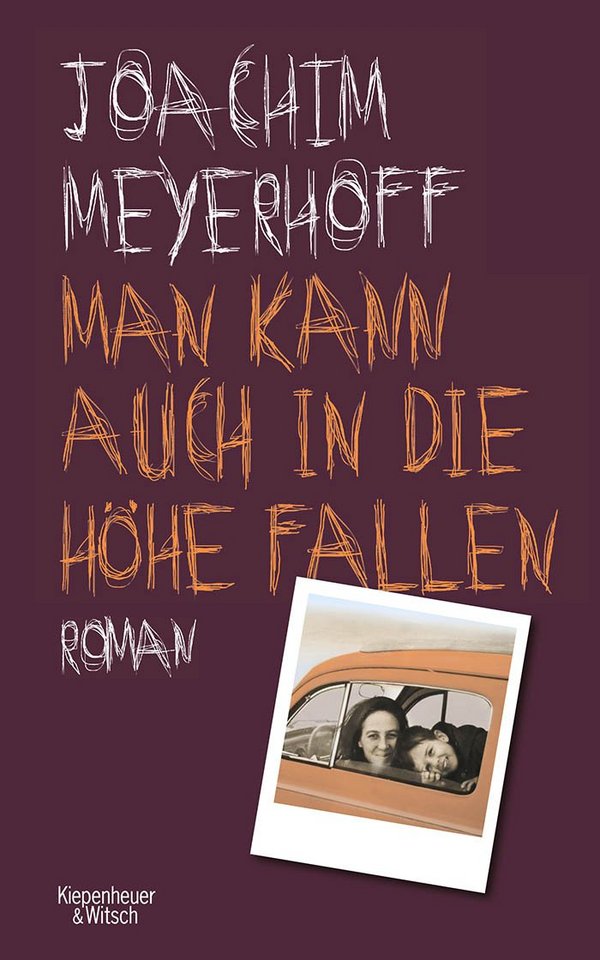
BUCHTIPP
Geschichten vom Mutterland
Von Christian Topp
Joachim Meyerhoff wird zum Naturereignis – sobald man ihm eine Bühne gibt. Das Theaterpublikum liebt ihn als intelligente Rampensau. Leserinnen und Leser verehren seine beiläufig welthaltige Kurzsatz-Prosa. „Man kann auch in die Höhe fallen“ ist bereits das sechste Buch des vielfach ausgezeichneten Schauspielers und wie alle seine Vorgänger autobiografisch geprägt. Die Rahmenhandlung ist unspektakulär: Der ausgebrannte Künstler flieht aus Berlin zu seiner 86-jährigen Mutter nach Schleswig-Holstein, um in der Landschaft seiner Kindheit wieder auf die Beine zu kommen. Anrührende, unspektakuläre Alltagsbeobachtungen verknüpft Meyerhoff beiläufig mit Anekdoten und teilweise aberwitzigen Geschichten aus dem Berufs- und Familienleben. Es entsteht eine Loseblattsammlung, die anderen Autorinnen und Autoren wohl in Beliebigkeit zerfließen würde. Meyerhoffs Text aber wird zusammengehalten von einem liebevoll klaren Blick auf sich, die Welt und vor allem auf seine Mutter, die man nach Ende der Lektüre gern einmal persönlich kennenlernen würde.
Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen, Kiepenheuer & Witsch 2024, 368 Seiten, 26 Euro
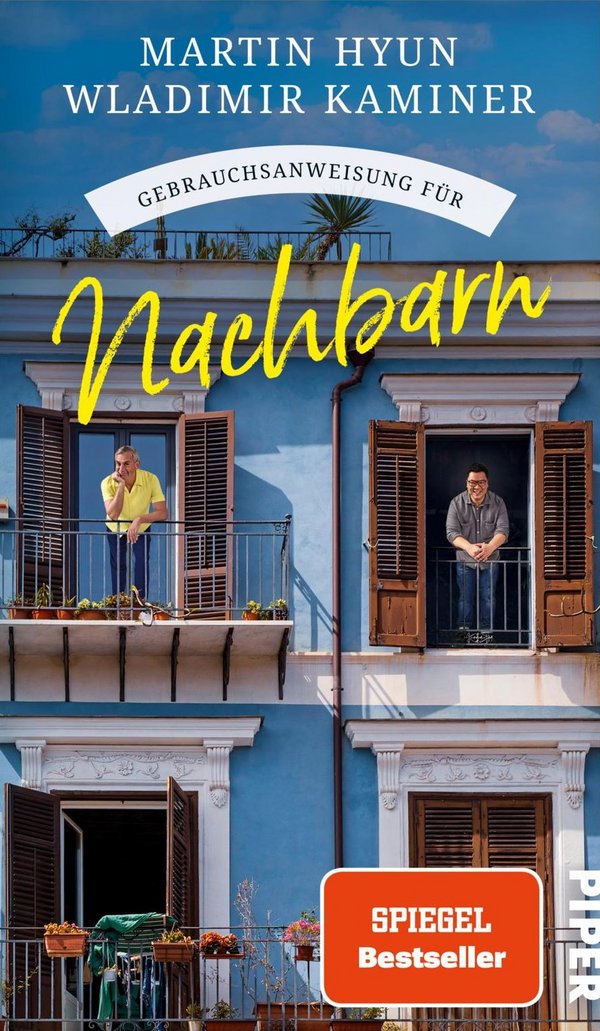
BUCHTIPP
Gebrauchsanweisung für Nachbarn
Von Antje Bohnhorst
Die beiden Autoren, die hier einen humor- und liebevollen Blick auf das Phänomen des Nachbarn werfen, haben beide einen Migrationshintergrund – und deshalb vielleicht einen erfrischend anderen Blick auf deutsche Eigenheiten. Wladimir Kaminer lebt seit 1990 in Deutschland und ist durch humorvolle Bücher mit tiefen Einsichten ins Zusammenleben der Menschen bekannt. Er beschreibt als Einstieg überzeugend, warum in einer Gemeinschaftswohnung in der Sowjetunion aufgewachsene Menschen mit milder Verwunderung und gesunder Distanz auf eifrig von wohlmeinenden Millenials geplante Gemeinschaftsaktivitäten in Berlin Mitte blicken – und sich freundlich, aber bestimmt raushalten. Martin Hyun, der als Sohn koreanischer Einwanderer in Krefeld geboren wurde, fand neben seiner Karriere als Eishockeyspieler durch die Beschäftigung mit der Geschichte seiner Familie und anderer koreanischer Einwanderer der ersten Generation, die sich vor allem unauffällig integrieren wollten, zu seiner Berufung als Schriftsteller. „Gebrauchsanweisung für Nachbarn“ ist ihr erstes gemeinsames Buch – Martin Hyun beschreibt die Arbeit daran als „eine Art literarisches Pingpong“. Hyun trägt analytische, fast philosophische Gedanken zu verschiedenen Nachbarschaftstypen bei – vom Zimmernachbarn bis zu benachbarten Ländern, gar Planeten –, Kaminer kleine literarische Gemmen von feinem, hintersinnigem Humor.