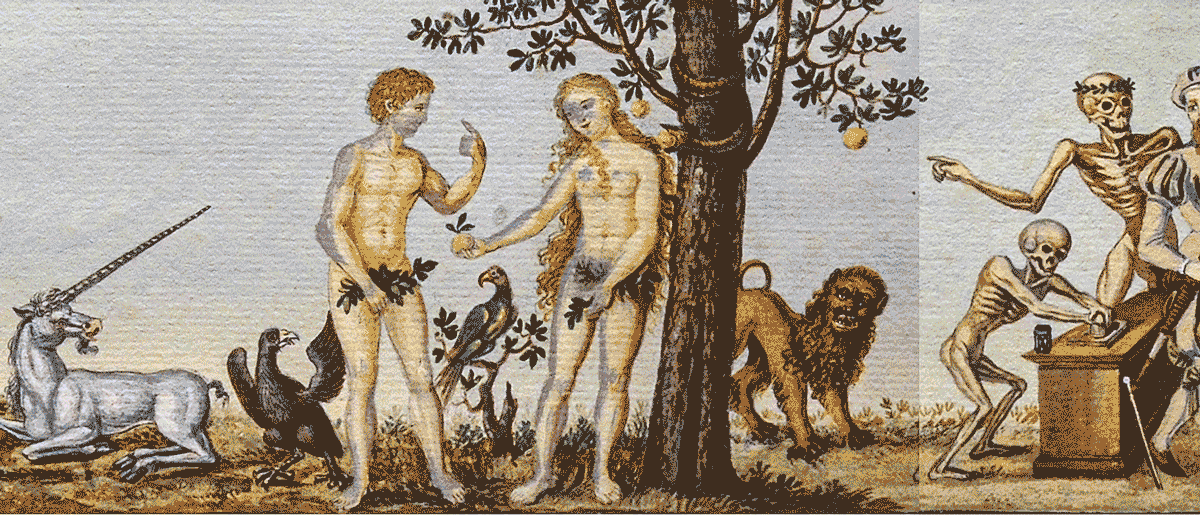Ränder des Lebens
Wie die Ars moriendi zu klugen Entscheidungen, verlässlichen Beziehungen und gemeinsamen Werten motiviert.
Von Rainer Liepold
Um Analphabeten philosophische Einsichten zu ermöglichen, bietet sich das Genre des Comics an. Bereits im Spätmittelalter bedienten sich die gelehrten Dominikaner dieser Technik. Damals war der Buchdruck noch nicht erfunden, und selbst in den Städten konnten nicht mehr als 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung lesen. Insofern lag es nahe, existenziell relevante Einsichten mit Hilfe von Bildern zu vermitteln. Eine Friedhofsmauer bot sich dabei als Plakatwand für einen philosophischen Comic offensichtlich besonders gut an: Schließlich waren die Menschen beim Besuch eines Grabs den Alltagsroutinen entnommen und in besonderer Weise offen, das eigene Leben mit seinen Grenzen zu reflektieren und nach dem Sinn des Daseins zu fragen.
Es war wohl das Jahr 1440, als auf die Mauer des Laienfriedhofs von Basel eine Bilderserie gemalt wurde, die dann unter dem Begriff „Totentanz“ berühmt geworden ist. 40 Bilder zeigen, wie ein Skelett sich seine Tanzpartner sucht: Weder der Bischof noch der Bettler, nicht die hübsche junge Frau und auch nicht der reiche Bürger sind davor sicher, dass der Tod sie zum finalen Tanz auffordert. Mal kommt er zu den Hochbetagten, die offensichtlich schon mit ihm rechnen, mal dreht sich eine noch junge, vitale Person ganz überrascht mit ihm im Reigen. Unser aller Leben ist endlich und niemand weiß, wie viel Zeit er noch hat. Das ist die Botschaft, zu deren Reflexion das Gemälde auf der Friedhofsmauer einlädt.
Zur Ehrenrettung der Dominikaner, die den philosophischen Comic in Auftrag gegeben hatten, ist Folgendes zu sagen: Sie wollten damit keineswegs Angst verbreiten oder die Betrachter des Kunstwerks zu einem demütigen Gehorsam erziehen. Nein, ihre philosophische Intention war deutlich sympathischer. Das Gemälde sollte die Betrachter dazu animieren, ihr Leben bewusster zu leben und Prioritäten richtig zu setzen. Gerade dass die Lebenszeit, die wir haben, begrenzt ist, macht sie letztendlich so wertvoll. Alles, was unbegrenzt vorhanden ist, hat keinen besonderen Wert. Weil jeder unserer Tage der letzte sein könnte, sind wir gut beraten, nicht achtlos mit unserem Dasein umzugehen.
Warum Unsterblichkeit ein Fluch wäre
Durch den Hollywood-Blockbuster „Fluch der Karibik“ segelt ein unheimliches Piratenschiff namens „Black Pearl“. Dessen Besatzung ist mit dem Fluch der Unsterblichkeit belegt. Die Untersterblichkeit erweist sich dabei aber keineswegs als Segen.
Es ist nämlich so, dass mit dem ausbleibenden Tod den Freibeutern zugleich auch alle Kontraste und jeglicher Sinn verloren gegangen sind. Zwar heilt jede im Kampf zugezogene Wunde umgehend wieder, aber dadurch werden die Piraten innerlich immer unberührbarer. Alle Herausforderungen, durch Mut und Loyalität zum Charakter zu reifen, gehen verloren. In der durch nichts zu unterbrechenden Endlosschleife ihres Lebens erkalten alle Emotionen. Das Essen schmeckt fad. Tag und Nacht verschwimmen in einem diffusen Dämmerlicht. Die infolge der Unsterblichkeit wertlos gewordene Zeit lässt sich nur mit regelmäßigen Besäufnissen totschlagen.
Auf diesem trostlosen Schiff möchte niemand anheuern. Denn tatsächlich erleben wir erst in der Auseinandersetzung mit unserer Endlichkeit, was das Leben wertvoll macht. Erst die Ars moriendi macht uns zum Menschen, indem sie uns lehrt, den Wert des Augenblicks bewusst zu genießen, indem sie uns herausfordert, ein produktives Verhältnis zu unserer Vulnerabilität zu entwickeln und unseren Egoismus in Sinn und Gemeinschaft zu transzendieren.
Das lebenserschließende Potenzial der Ars moriendi
Diese Erkenntnis hat bis heute das Potenzial zum Bestseller. „Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ – mit diesem geschickt gewählten Titel schaffte es die australische Krankenschwester Bronnie Ware im Jahr 2011 im Buchhandel ganz nach oben. Auf dem Buchcover versprach sie ihrer Leserschaft „Einsichten, die Ihr Leben verändern werden“ und erzählte dann von ihren Begegnungen mit Patienten, die unheilbar an Krebs erkrankt waren. Angesichts der nicht mehr zu verdrängenden Begrenztheit ihrer Lebenszeit fragten diese danach, was sie bislang aus und mit ihrem Leben gemacht haben: „Habe ich wirklich gelebt?“
Viele der unheilbar erkrankten Patienten verneinten dies im Rückblick. Nach Wares Beobachtung bedauern sie, einer ökonomisch verzweckten Gesellschaft, in der Opportunitätszwänge alle Lebensbezüge dominieren, nicht mehr emanzipatorische Selbstverwirklichung abgerungen zu haben. In der Retroperspektive sagen die Sterbenden: „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.“

Dr. Rainer Liepold ist Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er hat einen Dienstauftrag in der Altenheimseelsorge und begleitet Trauernde im digitalen Raum, u.a. mit dem Trauer- und Erinnerungsportal www.gedenkenswert.de.
Mit dieser Einsicht kann Bronnie Ware allerdings kein Alleinstellungsmerkmal in der Ratgebergeberliteratur für sich beanspruchen. Was ihr Buch von den anderen Ratgebern unterscheidet, ist nicht die Anleitung zur Selbstverwirklichung, die ja ohnehin für das Genre stilbildend ist. Es ist der starke Hebel, mit dem sie das Denken aus den gewohnten Verankerungen reißt. „Rechne jederzeit mit deinem Tod“ legt sie ihren Lesern ans Herz – und lebe deshalb jeden Tag so, dass es theoretisch dein letzter sein könnte. Aus dem Comic an der Basler Friedhofsmauer ist knapp 600 Jahre später ein 367 Seiten dicker Bestseller geworden.
Was wir der Todesangst entgegensetzen
„Das Bewusstsein dafür, dass wir Menschen sterblich sind, wirkt sich in so gut wie allen Bereichen des menschlichen Lebens tiefgreifend auf unser Denken, Fühlen und Verhalten aus – ob uns das nun bewusst ist, oder nicht“, stellt Shelden Solomon, ein US-amerikanischer Sozialpsychologe, fest.
Doch was macht das Wissen um unsere Endlichkeit mit uns? Diese Frage hat Solomon zu seinem wissenschaftlichen Lebensthema gemacht. Er gehört zu den Begründern der „Terror Management Theory“. Diese besagt, dass wir der Hilflosigkeit und Furcht angesichts der Unausweichlichkeit unseres Todes ganz explizit Lebenssinn entgegensetzen. Konkret zeigt sich dies daran, dass wir unsere eigene Existenz einordnen in ein System von Werten und Kollektiven, das uns überdauert.
1989 wurden Solomon und sein Forschungsteam mit einem erstmals durchgeführten Experiment bekannt, bei dem ein Amtsrichter aus einem US-Bundesstaat, in dem Prostitution verboten ist, eine Kaution für eine Ertappte festlegen musste: „Urteil über eine Hure“. Die Versuchsgruppe plädierte dabei im Durchschnitt auf einen Betrag von 50 Dollar.
Es gab aber noch eine weitere, gleich große, per Los bestimmte Referenzgruppe mit Richtern, die vor der Festlegung der Kaution noch eine zusätzliche Aufgabe erledigen mussten. Ihnen wurde ein leeres Blatt Papier vorgelegt: „Bitte beschreiben Sie all die Gefühle, die der Gedanke an Ihren eigenen Tod in Ihnen hervorruft.“ Nachdem sie unmittelbar davor mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert worden waren, setzten diese Amtsrichter dann im Durchschnitt eine 455-Dollar-Kaution fest.
Wie lässt sich erklären, dass diese Richter eine Straftat neunmal strenger sanktionierten als ihre Kollegen, denen davor die existenzielle Reflexionsschleife über ihre Endlichkeit erspart geblieben war? Solomon sieht darin einen Beleg dafür, dass das Wissen um unseren Tod in uns das Bedürfnis nach einer stabilen Ordnung, gemeinsamen Werten und einer verlässlichen Gemeinschaft weckt. Mit Hilfe des geschilderten Experiments – und vielen anderen ähnlich gelagerten – glaubt er, nachweisen zu können: In dem Moment, wo uns unsere Sterblichkeit bewusst wird, sehnen wir uns nach dem „Gefühl, dass wir Teil von etwas sind, das größer ist als wir selbst und noch lange nach unserem Tod fortdauern wird.“
Generativität als Treibsatz für eine lebendige Kultur
Besonders glücklich macht es uns, wenn es im Alter ganz konkret gelingt, jüngeren Menschen etwas Wertvolles mitzugeben. Wenn stolze Großmütter und -väter ein neugeborenes Enkelkind in den Armen halten, hoffen sie implizit immer auch, dass durch dieses Kind etwas von den eigenen Überzeugungen, Werten und Hoffnungen weiterleben wird.
Diese Bereitschaft, Haltungen, Glaubensgewissheiten und Kulturtechniken, die wir als identitätsstiftend erleben, an unsere Nachkommen weiterzugeben, bezeichnet der Psychoanalytiker Erik H. Eriksen als „Generativität“.
Kindern, Enkeln und Urenkeln etwas bleibend Wertvolles mitzugeben, erweist sich allerdings als erfrischend komplexe Herausforderung. Den von einem rein konservativen Ethos beseelten Alten – bewahren, was sie selbst als bewahrenswert erleben – drohen nämlich frustrierende Erfahrungen. Nach Erikson liegt das Potenzial der Generativität gerade in der Überwindung von Selbstbezogenheit und Stagnation. Sie gelingt nur in einem Austausch auf Augenhöhe. Dies impliziert die Bereitschaft, sich hinterfragen zu lassen und sich möglichst unbefangen und neugierig auf die Sichtweisen und Erlebnisse junger Menschen einzulassen. Wer dies im höheren Lebensalter tut, tut dabei auch sich selbst etwas Gutes: Nachkommen sind dann keine Projektionsfläche eigener Wünsche mehr, sondern vielmehr Dialogpartner, die zu einer bleibenden Auseinandersetzung mit existenziellen Lebensfragen inspirieren.
Seniorinnen und Senioren, die erleben, dass dieses Gespräch zwischen den Generationen gelingt, sind prädestiniert für ein sinnerfülltes Alter, das gesellschaftliche Partizipation sowie die Übernahme und Neuentdeckung konstruktiver Rollen beinhaltet.