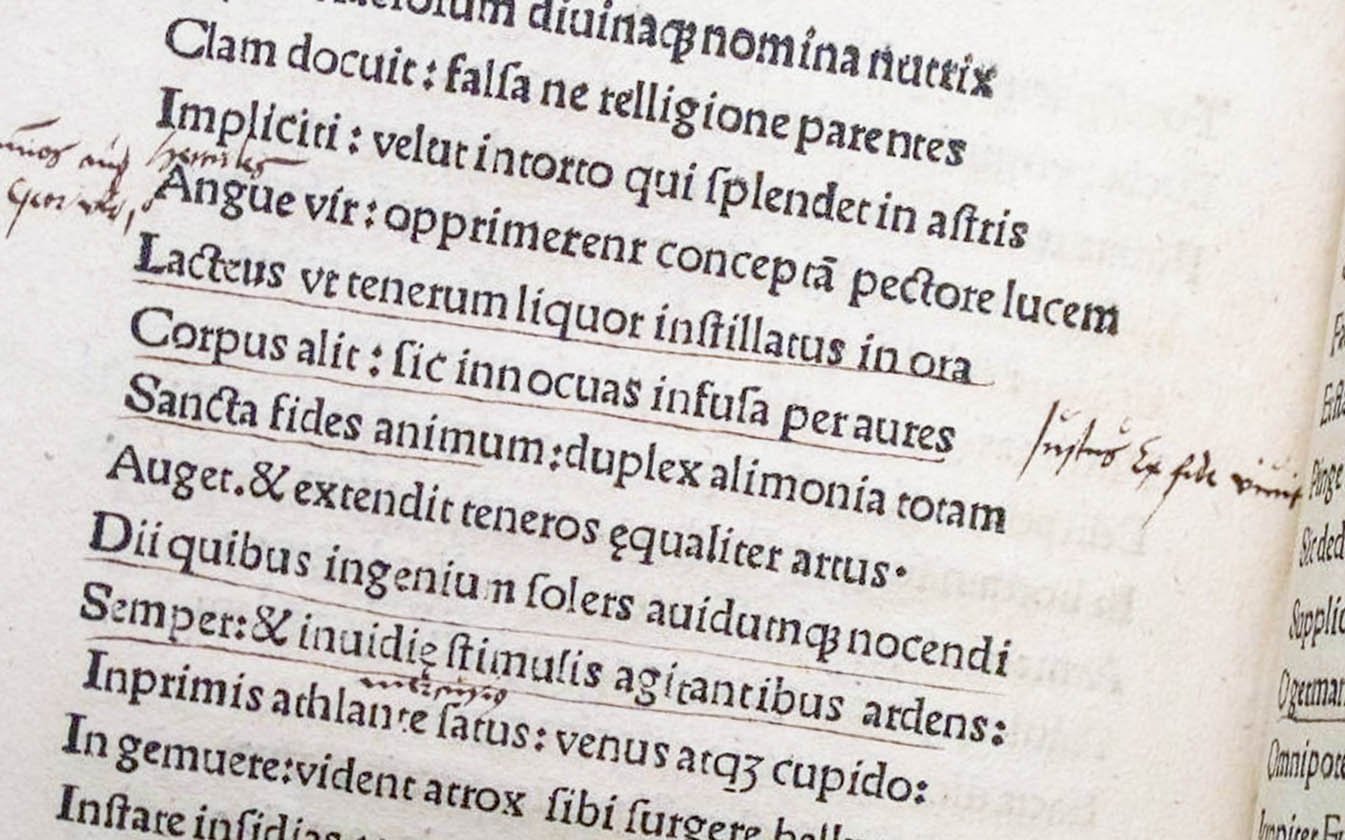An der Seitenlinie
Am Rand zu stehen hat einen schlechten Ruf. Dabei sollte man manchmal genau von dort auf die Welt blicken, um endlich Zeit und Muße zu haben, die eigenen Wege zu prüfen und neu auszurichten.
Von Alexander Brandl
Vielleicht war ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Anders kann ich mir die Ereignisse im Rückblick nicht erklären. Es ist ein Septembermorgen, als mein Gehör einfach so aufhört zu funktionieren. Meine erste Reaktion auf die scheppernde Stimme des Radiomoderators: Na toll – der Lautsprecher ist kaputt. Erst als das „Guten Morgen“ meines Mannes so roboterhaft klingt wie die Stimme aus dem Radio, setzt Panik ein. Die Diagnose beim HNO-Arzt: Hörsturz. Rund ein Jahr würde es dauern, bis mein Gehirn lernt, mit den teilweise unwiderruflich zerstörten Hörnerven so umzugehen, dass eine Stimme wieder wie eine Stimme klingt. Bei der Frage nach der Ursache bleibt mein Arzt so vage wie die Ergebnisse meiner Google-Recherche. Stress. Wahrscheinlich. Die Allround-Begründung für so ziemlich alles heutzutage.
Aber vielleicht geht es bei Diagnosen sowieso weniger darum, was sie beschreiben, als vielmehr darum, was wir aus ihnen machen. Der Hörsturz lieferte das dissonante Grundrauschen für eine schmerzhafte Übergangsphase. Ich wähnte mich in der Mitte des Lebens, in Saft und Kraft. Dabei stand ich längst am Rand. Trotzdem ging ich weiter. Aber da war kein Grund mehr unter meinen Füßen. Da war ein Abgrund. Ich stolperte hinein. Im Rückblick sage ich: Endlich bin ich gestolpert. Über die Frage, die ich jahrelang unter den Teppich gekehrt hatte. Ist das wirklich das Leben, das ich leben will? Diesen Sinn habe ich dem Hörsturz nachträglich gegeben: dass er mich dazu veranlasste, diese Frage zu stellen. Medizinisch korrekt ist das bestimmt nicht. Und doch war es richtig für mich.
Ich wurde in eine Zwangspause versetzt. Kein Gedudel. Keine Ablenkung mit sozialen Medien. Alles war Lärm geworden. Nur ich und meine Gedanken. Zwei Wochen lang. Es begann eine Phase, an deren Ende der Abbruch einer Doktorarbeit stand. Und noch mehr Abbrüche. Und Neuanfänge. Und ein neues Selbstkonzept. Bis ich irgendwann wieder Boden unter den Füßen hatte. Ich war auf einer anderen Seite angekommen, von deren Existenz ich zuvor nichts geahnt hatte. Es gab nun ein Vorher und ein Nachher.
Schwellen. Ränder. Grenzbereiche. Zeigt sich dort, wer wir wirklich sind? Der Ethnologe Victor Turner spricht von liminalen Räumen. Es sind Schwellenzustände. Der Klassiker: die Jugend. Nicht mehr Kind. Noch nicht erwachsen. Aber was denn dann? Da passt es, dass bei jungen Menschen auf der Kurzvideo-Plattform TikTok in letzter Zeit das Stichwort „liminal spaces“ zum Trend geworden ist. Ein Sammelbegriff für unzählige Fotos und Videos aus der ganzen Welt. Was sie verbindet: Es sind Aufnahmen vom Rand, von der Schwelle. Von dort, wo etwas verschwimmt. Zwischenorte. Übergangsorte. Lange Hotelflure zum Beispiel. Verlassene Treppenhäuser. Leer stehende Fabrikgebäude. Orte, die auf etwas verweisen, das nicht direkt zu sehen ist. Die ihren Zweck nicht in sich selbst haben. Der Hotelflur und das Treppenhaus sind Durchgangsorte. Das Eigentliche befindet sich hinter den Türen. Die Fabrik verweist auf etwas, das nicht mehr ist. Die Zeit verschwimmt für die Betrachtenden. Millionenfach werden die Aufnahmen von jungen Menschen geklickt. Weil sie Spiegel ihrer Seele sind?
Am Rand stehen – es hat einen schlechten Ruf. Man sagt: Jemand wird an den Rand gedrängt. Folglich sind dort die Schwachen, die Abgehängten. Die Mitte ist dann das Ideal, die Norm. Diese Sicht hat mich lange geprägt. Und nicht nur mich. Karriere machen heißt oft: rein in die Mitte. Platz da. Dabei hätte ich es besser wissen können. In der Mitte spielt vielleicht das Leben, aber erst am Rand stehend habe ich Zeit und Muße, meine Wege zu prüfen und vielleicht neu auszurichten. Die Seitenlinie habe ich dennoch lange gescheut. Vielleicht lag es am horror vacui, an der Angst vor der Leere. Als wären die Erde und das Leben eine Scheibe, und wer sich zu weit von der sicheren Mitte entfernt, droht ins Nichts zu plumpsen.
Meine Hoffnung ist: Die Generation nach mir geht es anders an. Die „liminal spaces“, die so im Trend liegen, sind allesamt leere Räume. Menschenleer. Schauderhaft für die einen. Beruhigend für die anderen. Und voller möglicher Geschichten. Vielleicht habe ich immer am falschen Ort gesucht: in der Mitte. Und das Eigentliche, es ist an den Rändern versteckt, an den Schwellen, im Uneigentlichen. Stimmt ja: Es war schrecklich und wunderbar zugleich, im Sportunterricht in kein Fußball-Team gewählt zu werden, weil ich frei von jeglichem Talent war. Schrecklich die Einsamkeit auf der Holzbank am Rand des Spielfelds. Und wunderbar das Gefühl, meine Lebenszeit nicht diesem Ball widmen zu müssen. Oder meine Zeit als Statist bei Theater- und Opernproduktionen, zu einer Zeit, als ich noch mit dem Gedanken spielte, Schauspiel zu studieren. Schrecklich die stumme Rolle, die zweite Riege. Wunderbar das Gefühl, heute nicht so leben zu müssen wie viele, die ich aus der Branche kenne: von Engagement zu Engagement tingelnd, unstet, immer knapp bei Kasse.
Was ist die Mitte, was ist der Rand? Was ist das Eigentliche, was das Uneigentliche? Ich finde es erst heraus, wenn ich mich hinauswage an die Grenzen dessen, was mir vertraut ist. Über Schwellen trete. Dort wartet Unsicherheit. Dort warten aber auch: Neue Wege. Neue Selbstbilder. Es braucht dazu keinen Hörsturz, keinen Zusammenbruch. Es braucht nur einen Schritt. Und los.

Alexander Brandl, 39, ist Rundfunkpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Vorstand des Geistlichen Zentrums im Evangelischen Kloster Schwanberg bei Würzburg. Für das forum schreibt er regelmäßig über theologische und philosophische Themen. Auf Instagram ist er unter dem Namen @alpha.oh.mega zu finden.